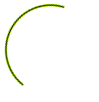Mais: Höhere Erträge durch mehr aktive Gene

Bei Mais kann der sogenannte Heterosis-Effekt sogar zu einer Verdopplung des Ertrags führen. (Quelle: © iStockphoto.com/ Amanda Rohde)
Ein Forscherteam entdeckte bei Maispflanzen einen möglichen Mechanismus für den sogenannten Heterosis-Effekt. Dieser bezeichnet die höhere Leistungsfähigkeit von Mischlingen (Hybriden) im Vergleich zu ihren reinerbigen Eltern. Untersuchungen zeigten, dass in den Hybrid-Pflanzen mehr Gene aktiv sind als in den reinerbigen Sorten. Diese zusätzlich aktiven Gene könnten der Grund für ein besseres Wachstum und eine gesteigerte Produktivität der Pflanzen sein.
Mais (Zea mays L.) ist eine wirtschaftlich bedeutende Getreideart. Er wird nicht nur als Nahrungs- und Futtermittel genutzt, sondern auch für die Produktion von erneuerbarer Energie. 2010 wurden weltweit über 840 Millionen Tonnen an Mais produziert (FAOSTAT). Auch in Deutschland ist Mais eine bedeutende Nutzpflanze: Laut statistischem Bundesamt wurden 2011 über 1,9 Millionen Tonnen Mais nach Deutschland eingeführt.
Neue Studie widmet sich der Aufklärung des Heterosis-Effekts
Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die Forschung darum bemüht, die Ernteerträge der Maispflanze zu steigern. Eine wichtige Züchtungsmethode, um leistungsfähigere Sorten zu erzeugen ist die sogenannten Heterosiszüchtung: Aus der Kreuzung zweier reinerbiger Inzuchtlinien gehen Mischlinge (Hybride) hervor, die leistungsfähiger sind als ihre reinerbigen Eltern. Die erhöhte Leistungsfähigkeit der Hybride bezeichnet man allgemein als Heterosis-Effekt.
Auch Mais-Hybride liefern höhere Erträge. So haben die Nachkommen beispielsweise längere Maiskolben, sind widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten oder können sich besser an veränderte Umweltbedingungen anpassen. Bei Getreidearten wie Mais oder Roggen kann dies sogar zu einer Verdopplung des Ertrags führen. Dies ist auch der Grund, warum sich Hybridsorten, obwohl diese nicht mehr im Nachbau angebaut werden können und jährlich von den Landwirten nachgekauft werden müssen, in der Praxis durchgesetzt haben.
Bereits seit mehr als 100 Jahren ist dieser Effekt bekannt. Die genetische Ursache des Heterosis-Effektes, ist trotz seiner großen agronomischen Bedeutung noch nicht vollends geklärt.
Eine Hypothese besagt, dass sich vorteilhafte genetische Ausprägungen (Allele) des Erbguts der beiden reinerbigen Eltern in Hybriden gegenseitig ergänzen. Somit werden in der 1. Tochter bzw. Filial-Generation (F1-Generation) wünschenswerte Eigenschaften eher ausgeprägt. Eine neue Studie untermauert die Hypothese nun durch molekularbiologische Untersuchungen.
Eine erhöhte Genaktivität könnte die Lösung sein
Deutsche Forscher der Universität Bonn und des Max-Planck-Instituts für Entwicklungsbiologie in Tübingen untersuchten zusammen mit Kollegen aus den USA die molekularen Grundlagen des Heterosis-Effektes bei Maispflanzen.

An Maiswurzeln erforschten Dr. Anja Paschold und Prof. Dr. Frank Hochholdinger, warum Hybrid-Pflanzen deutlich höhere Erträge bringen als reinerbige Sorten.
Bildquelle: © Barbara Frommann / Uni Bonn
Die Wissenschaftler zogen hierfür reinerbige Elternpflanzen (Inzuchtlinien: B73 und Mo17) und Hybride dieser Linien (B73 × Mo17 und Mo17 × B73) auf. Danach analysierten sie die Gesamtheit aller aktiven Gene (Transkriptom) in den Wurzeln der Maispflanzen, d.h. sie betrachteten die Gesamtheit der RNA-Moleküle, die durch das ablesen (Transkription) der Gene entstanden sind. Da die Gene Baupläne für Eiweiße sind, können die Zellen durch diese „Gen-Kopien“ letztlich Proteine bilden. Werden also die Gene abgelesen, sind sie quasi „aktiv“. Dabei verwendeten die Forscher moderne Hochdurchsatz-RNA-Sequenzierungsmethoden, auch „Next Generation Sequencing“-Methoden genannt. Dies gewährleistete eine schnelle und genaue Analyse der RNA.
In den Elternpflanzen waren knapp 34.000 Gene aktiv (Sorte B73 = 33.460; Sorte Mo17 = 33.874). Die Forscher entdeckten, dass in beiden Tochtergenerationen hunderte von zusätzlichen Genen exprimiert wurden. In den Nachkommen sind demnach mehr Gene aktiv, als in ihren Eltern. Die Forscher vermuten daher, dass die erhöhte Genaktivität für den Heterosis-Effekt verantwortlich ist. „Es handelt sich bei den etwa 350 bis 750 zusätzlich aktiven Genen im Vergleich zu den etwa 34.000 aktiven Genen um eine vergleichsweise geringe Zahl“, sagt Prof. Hochholdinger, Inhaber des Lehrstuhls für funktionelle Genomik der Nutzpflanzen an der Universität Bonn, der bei der Studie beteiligt war. „Dennoch könnte der individuell vermutlich sehr geringe Beitrag jedes dieser Gene in Summe für den Wachstumsschub bei den Hybriden sorgen.“
Da die genauen Funktionen dieser einzelnen Gene bisher noch nicht bekannt sind, wollen die Wissenschaftler nun im nächsten Schritt erforschen, welchen Vorteil diese zusätzlich aktiven Gene konkret haben.
Praktische Anwendung in der Landwirtschaft
Dieses Wissen könnte zukünftig auch die Züchtung vereinfachen. Die Wissenschaftler hoffen, dass sich unter den zusätzlich aktiven Genen der Maishybride, auch hilfreiche molekulare Marker befinden. Mit Markergenen können Bereiche im Genom eindeutig identifiziert werden. Denn um die Maiszüchtung effizienter zu gestalten, sucht man nach Möglichkeiten, schon vorab Pflanzenlinien zu identifizieren, mit denen Nachkommen mit gewünschten Eigenschaften gezielter erzeugt werden können. Diese Methode nennt man auch Smart Breeding. Auf diese Weise könnte man Zeit und Geld sparen, da die herkömmliche Vorgehensweise, die Kreuzung von tausenden unterschiedlichen Inzuchtlinien, sehr aufwendig und teuer ist.
Quelle:
Paschold, A. et al. (2012): Complementation contributes to transcriptome complexity in maize (Zea mays L.) hybrids relative to their inbred parents. In: Genome Research 2012, 22: 2445-2454, 19. Oktober 2012, doi: 10.1101/gr.138461.112.
Video: Statement von Prof. Hochholdinger
Zum Weiterlesen: