

Wie
alles
begann …
Pflanzenzucht
als Basis der
Zivilisation
Wozu Pflanzenzüchtung?
Kulturpflanzen sind seit etwa 12.000 Jahren unsere Lebensbasis. Aus wenig nahrhaften Wildpflanzen entstanden über Jahrtausende durch Züchtung unsere heutigen ertragreichen Kulturpflanzen. Aus Jägern und Sammlern wurden Landwirte. Und mit dem züchterischen Fortschritt gelang es, dass ein einzelner Landwirt immer mehr Menschen mit Nahrung versorgen konnte – die Grundlage für unsere arbeitsteilige Gesellschaft und Zivilisation.
Während die Methoden sich im Laufe der Zeit verändert haben, sind die Ziele der Pflanzenzüchtung seit jeher gleich geblieben: Pflanzen sollen mehr Ertrag liefern, mehr nahrhafte Inhaltsstoffe enthalten und gleichzeitig widerstandsfähiger gegen Schädlinge, Krankheiten und widrige Klimabedingungen werden.
Die moderne Pflanzenzüchtung kann immer schneller und präziser züchten. Eine richtige Erfolgsgeschichte, die aber weitergehen muss. Denn die Weltbevölkerung wächst rasant und die Kulturpflanzen müssen an den Klimawandel angepasst werden. Also: Let’s breed and grow!
12.000 Jahre lang kultivierten Menschen Pflanzen nur durch Auslese. Doch dann kam ein Mönch ...

Gregor Mendel
und seine Regeln
„Vater der Genetik“, so wird Gregor Mendel auch genannt. Er wollte wissen, mit welchen Gesetzmäßigkeiten Eigenschaften von Elternpflanzen an Nachkommen vererbt werden. Dazu kreuzte er im Klostergarten Erbsenpflanzen mit unterschiedlichen Eigenschaften, z. B. violette oder weiße Blüten sowie gelbe oder grüne Samen. Bei den Nachkommen zählte er, wie oft bzw. in welchen Kombinationen die einzelnen Merkmale auftraten. Aus seinen Beobachtungen konnte er drei Regeln der Vererbung ableiten. Sie bilden heute die wissenschaftliche Grundlage für die moderne Züchtung. Denn mit diesem Wissen wurde es möglich, die unterschiedlichen Eigenschaften von Elternpflanzen gezielt in den Nachkommen zu kombinieren. Ein Meilenstein der Züchtungsgeschichte!
Erbsen
zählen als Wissenschaft
Die Mendelschen
Regeln der Vererbung
Die Erträge von Pflanzen zu steigern, war immer noch mühselig. Aber eine neue Methode führte zur "Ertragsexplosion".

Hybridzüchtung
Ein interessantes Phänomen hilft Züchtern, besonders leistungsfähige Pflanzen zu erzeugen. Dazu kreuzen sie zwei Pflanzen einer Art, die sich in einem gewünschten Merkmal genetisch unterscheiden und dabei reinerbig (homozygot) sind. Dadurch entstehen größere, sehr ertragreiche und widerstandsfähigere Nachkommen (Hybride). Der „Sohn“ ist somit ein Goliath im Vergleich zum „Vater“. Das nennen die Züchter den „Heterosis-Effekt“. Allerdings bleibt er nur für eine Generation erhalten. Deshalb müssen Landwirte für die nächste Aussaat Hybridsaatgut vom Züchter nachkaufen.
Wie der
Vater …
so der Sohn.
Oder etwa nicht?
Hybridzüchtung
Kreuzt man zwei Pflanzen, entsteht im Erbgut richtiges Chaos. Im Labor fand man die Lösung …
Doppelhaploiden-Technologie (DH)
Nach der Kreuzung zweier Pflanzen enthalten die Nachkommen immer einen Chromosomensatz vom Vater und einen von der Mutter. Sie sind also mischerbig. Was passiert, wenn diese Pflanzen weiter vermehrt werden? Die unterschiedlichen Erbinformationen in den väterlichen und mütterlichen Chromosomen werden neu kombiniert und es entstehen plötzlich Nachkommen mit unerwünschten Eigenschaftskombinationen. Der Züchter kann aber auf einen Trick zurückgreifen, um das zu verhindern. Dazu nimmt er unreifen Pollen, der nur einen einfachen Chromosomensatz enthält und verdoppelt diesen Chromosomensatz im Labor. Es entstehen doppelhaploide Pflanzen mit reinerbigen (homozygoten) Chromosomensätzen. Diese und ihre Nachkommen sind dadurch genetisch stabil.
Mit der Zeit setzten Pflanzenzüchter auch neue Werkzeuge ein. Eines davon könnte aus einem James Bond Film stammen …
Früher mussten Züchter vor allem Geduld mitbringen, um die Eigenschaften ihrer Pflanzen kennenzulernen. Heute geht das viel schneller!
Kirchturm als Marker
Wirtshaus
Markergestützte Selektion (MAS)
Früher mussten Züchter ihre Pflanzen immer erst monatelang beobachten, um ihre Eigenschaften kennenzulernen. Heute verrät der Blick ins Erbgut schon bei aufkeimenden Pflanzen, welche Merkmale sie einmal entwickeln werden. Bei der markergestützten Selektion suchen die Züchter im Labor bestimmte Genabschnitte (Marker) im Erbgut, die bekanntermaßen in der Nähe gewünschter Gene – z. B. einem Pilzresistenzgen – liegen. Findet man in den Nachkommen nun diesen Marker, weiß man, dass auch die Pilzresistenz vererbt wurde. Das beschleunigt den Züchtungsprozess ungemein.
Eine andere bildliche Erklärung, was ein „Marker“ ist, stammt aus einem Lehrbuch („Pflanzenzüchtung“, Becker, 2011). Hier heißt es: „Wenn man in Bayern eine Wanderung unternimmt und Lust auf ein kühles Bier bekommt, sollte man nach einem Kirchturm Ausschau halten. In Bayern liegt nämlich neben jeder Kirche ein Wirtshaus. Der weithin sichtbare Kirchturm ist der „Marker“, das in unmittelbarer Nähe liegende Wirtshaus ist das eigentliche Ziel.“
Die Kirchtürme
in den Erbanlagen
Markergestützte Selektion Mehr erfahren
Für mehr Vielfalt können Züchter auch Mutationen künstlich erzeugen. Bis vor Kurzem setzte man dafür erbgutverändernde Substanzen oder Strahlung ein. Heute geht das präziser.
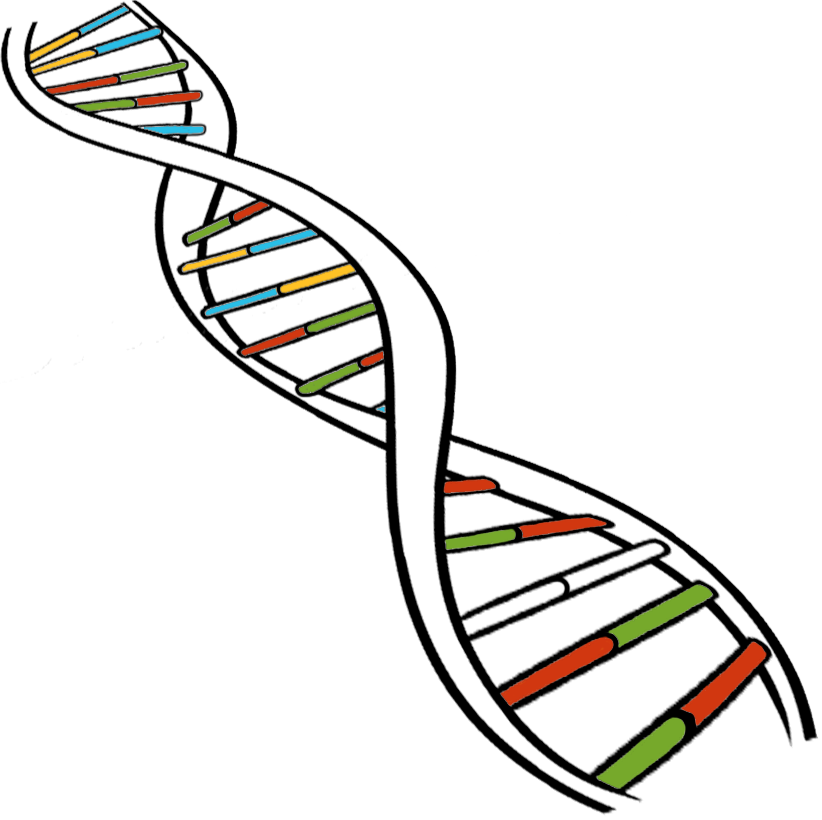
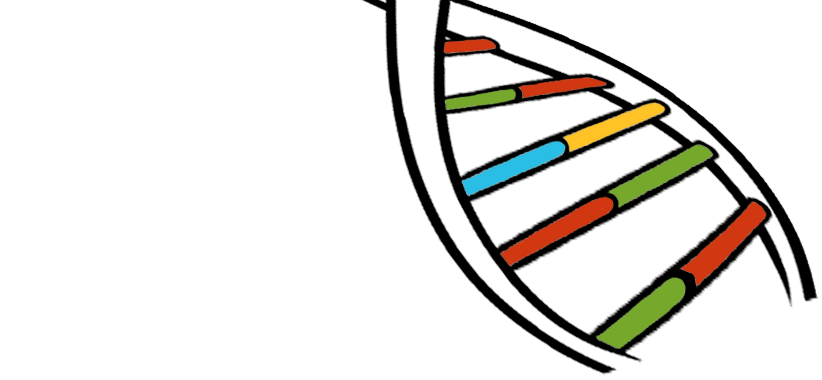
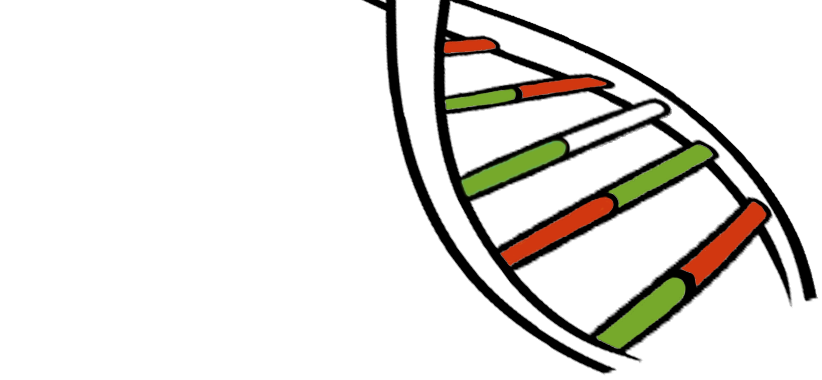
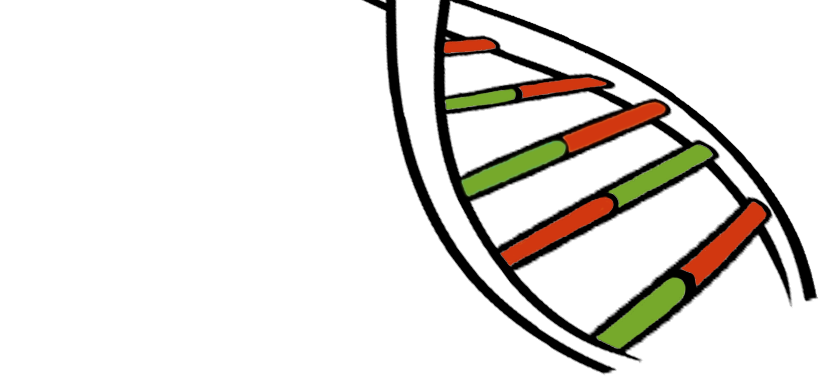



Genome Editing
Mit den neuen Methoden des Genome Editings, insbesondere der „Gen-Schere“ CRISPR/Cas, stehen den Züchtern neue Werkzeuge zur Verfügung, die zielgenaue Veränderungen im Genom ermöglichen.
Dieses „CRISPR-Werkzeug“ besteht im Wesentlichen aus einem Stück RNA (Guide-RNA), das an eine gewünschte Stelle im Genom bindet. Das an die RNA gekoppelte „Schneide“-Protein (Cas9) durchtrennt den DNA-Strang an dieser Stelle. Anschließend repariert sich die Zelle selbst. Danach ist das betroffene Gen in seiner Sequenz aber verändert, beispielsweise funktionsunfähig. Bei Weizen konnte so eine Resistenz gegen Mehltau erzeugt werden. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes im Jahr 2018 werden Genom-Editing-Techniken als gentechnische Verfahren eingestuft. Die mit diesen Methoden veränderten Pflanzen gelten daher als gentechnisch veränderte Organismen (GVO).
Und nicht vergessen: Nach der Züchtung kommt noch eine schwere Prüfung.
Vom Züchter auf den Acker –
Der lange Weg zur zugelassenen Sorte
Hat ein Züchter eine neue Pflanze entwickelt, dürfen Landwirte sie noch nicht sofort anbauen. Sie muss erst noch als Sorte zugelassen werden, bevor der Züchter sie vermarkten kann. Dazu überprüft das Bundessortenamt unter anderem, ob die Pflanze im Vergleich zu bereits zugelassenen Sorten bessere Anbau- und Verwertungseigenschaften hat. Beispielsweise soll die neue Pflanze eine stärkere Resistenz gegenüber Krankheiten aufweisen oder höhere Erträge liefern. Eine solche Prüfung dauert in der Regel vier bis fünf Jahre. Von jährlich etwa 1.000 zur Prüfung angemeldeten Sorten werden nur etwa 150 - also nur 15 % - zugelassen. Good luck!







