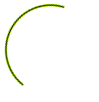Bioraffinerien ersetzen die Petrochemie

Aus Raps lässt sich weit mehr als nur Speiseöl gewinnen. (Quelle: © Petra Schmidt / pixelio.de)
Pflanzen sind nicht nur eine erneuerbare Energiequelle, sie sind auch klimafreundlicher Rohstoff für die chemische Industrie. Noch steht das Konzept der Bioraffinerien am Anfang, doch die Möglichkeit, Pflanzen vollständig zu verwerten, dürfte den Ansatz profitabel machen.
Ob Einkaufstüte, Nylonstrumpfhose oder Tennisschlägerbespannung: Am Anfang stand das Erdöl. Das schwarze Gold bildet den Ausgangspunkt vieler Kunststoffe und Chemikalien, in die es in Raffinerien umgewandelt wird. Bislang war diese Rolle der Petrochemie unangefochten. Zwar wäre auch Kohle als Rohstoff geeignet, doch die für die Umwandlung in wertvolle Stoffe nötige Chemie ist aufwändig und teuer. Einen Boom erlebte die Kohlechemie in Deutschland zwei Mal: Zum einen während des zweiten Weltkriegs. Damals kam die Versorgung mit ausländischen Rohstoffen praktisch zum Erliegen, und die heimische Kohle bot die einzige Alternative. Zum anderen spielte sie während der gesamten Existenz der DDR eine Rolle, da auch hier die Ressourcen sowie ausländische Devisen Mangelware waren. Bis zur Wiedervereinigung existierte in der DDR eine intensive Kohleforschung. Unter normalen Bedingungen müsste sich der Preis des Erdöls jedoch vervielfachen, bevor Kohle für die Chemie eine echte Alternative zum Erdöl werden könnte.
Grund- und Feinchemikalien aus Biomasse
Aus einer ganz anderen Richtung bekommt das Erdöl jetzt trotzdem Konkurrenz, eine Konkurrenz, die obendrein umwelt- und klimafreundlich ist: aus der Landwirtschaft. Längst sind Pflanzen als Quelle für Brenn- und Treibstoffe etabliert, und nun wollen Wissenschaftler aus ihnen im großen Maßstab Grund- und Feinchemikalien gewinnen. Denn pflanzliche Biomasse enthält zu 75 Prozent Kohlenhydrate, zu 20 Prozent den Faserstoff Lignin sowie Eiweiße, Fette, Vitamine, Farbstoffe und Geschmacksstoffe.
Letztlich sollen Pflanzen in Bioraffinerien als Grundlage für Nahrungsmittel, Futtermittel, Chemikalien, Werkstoffe, Gebrauchsgüter und Kraftstoffe dienen. Die Logik dahinter ist so einfach wie bestechend: Warum sollte man die Pflanze nur für einen Zweck verwerten und die Reste wegwerfen, wenn man ihre unterschiedlichen Bestandteile auch der Reihe nach für verschiedene Zwecke verwenden und die Pflanze so komplett verwerten kann? Kaskadennutzung heißt das in der Fachsprache.
Der analoge Gedanke liegt seit Jahrzehnten den Ölraffinerien zugrunde, weshalb sich das Grundkonzept der Bioraffinerie an den etablierten chemischen Abläufen der Petrochemie orientiert. Im ersten Schritt einer Bioraffinerie wird die Biomasse einer physikalischen Stofftrennung unterworfen. Die Haupt- und Nebenprodukte werden dann mikrobiologischen und/oder chemischen Umwandlungsreaktionen sowie thermischen Prozessen ausgesetzt. Die Folgeprodukte können weiter umgeformt oder in einer konventionellen Raffinerie weiter verarbeitet werden. Drei Typen der Bioraffinerie verdienen besondere Beachtung: die Grüne Bioraffinerie, die Lignocellulose-Feedstock-Bioraffinerie und die Getreide-Ganzpflanzen-Bioraffinerie.
Die Grüne Bioraffinerie
Die Grüne Bioraffinerie nutzt grüne, „naturfeuchte“ Rohstoffe wie Gras, Luzerne, Klee und unreifes Getreide, um daraus Futtermittel, Eiweiße, Brennstoffe, Chemikalien und über mikrobiologische Fermentation auch Produkte wie organische Säuren, Aminosäuren, Ethanol oder Biogas zu erzeugen. Dazu wird die grüne Biomasse in Presskuchen und in Presssaft getrennt. Beim grünen Presssaft liegt der Fokus auf Produkten wie Milchsäure, Aminosäuren, Ethanol und Eiweißen. Aus dem Presskuchen können Futterpellets hergestellt werden, oder er dient als Ausgangsmaterial zur Produktion von Chemikalien wie Lävulinsäure oder zur Umwandlung in synthetische Kraftstoffe.
Die Lignocellulose-Feedstock-Bioraffinerie
Eine Lignocellulose-Feedstock-Bioraffinerie erzeugt aus den „naturtrockenen“ Rohstoffen Stroh, Gras, Waldrestholz und cellulosehaltigen Abfällen wie Papier Produkte in drei verschiedenen Linien: In der Lignin-Linie können Klebstoffe, Bindemittel, Brennstoffe oder Chemieprodukte hergestellt werden. In der Hemicellulose-Linie können Verdickungsmittel und Folgeprodukte der Xylose, beispielsweise Nylon, produziert werden. Und in der Cellulose-Linie werden aus Glucose Fermentationsprodukte wie Ethanol oder Milchsäure gewonnen.
Die Getreide-Ganzpflanzen-Bioraffinerie
In einer Getreide-Ganzpflanzen-Bioraffinerie können aus Getreidestroh ebenfalls Produkte der Lignin-, Hemicellulose- und Cellulose-Linien erzeugt werden. Rohmaterialien sind hier Roggen, Weizen, Triticale und Mais. Wird das Stroh vergast, lassen sich aus dem Synthesegas, einem wasserstoffhaltigen Gasgemisch, Produkte wie Methanol oder Polyhydroxybutyrat gewinnen. Die Stärke im Korn lässt sich in Folgeprodukte wie Glucose, Acetatstärke, Glucosamine und Kunststoffe weiterverarbeiten.
Vorstellbar wäre auch, zwei unterschiedliche Konzepte in einer Raffinerie zu vereinen, sowohl Zucker zu erzeugen und zu verarbeiten als auch Synthesegas zu bilden. Die Zucker-Plattform würde auf biochemischem Weg die Biomasse verwerten, die Synthesegas-Plattform würde thermochemische Verfahren wie das Fischer-Tropsch-Verfahren nutzen, das bei Biokraftstoffen der zweiten Generation zum Einsatz kommt.
Unter den potenziellen Bioraffineriekonzepten könnte sich die Lignocellulose-Feedstock-Bioraffinerie vermutlich am ehesten durchsetzen. Die benötigten Rohstoffe seien gut verfügbar und ihre Umwandlungsprodukte am Markt gefragt, urteilte im März 2007 das Büro für Technik-Folgenabschätzung beim Deutschen Bundestag.
Bottom-up- oder Top-down-Ansatz?
Teilkonzepte von Bioraffinerien werden bereits eingesetzt, meist nach dem Bottom-up-Ansatz: Vorhandene Anlagen für einzelne Produkte werden so verändert, dass sie auch Biomasse als Ausgangsbasis nutzen können oder weitere Produkte erzeugen. So entstanden 2005 in Deutschland 15.000 Tonnen kurzlebige Kunststoffverpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen – bei einer Gesamtproduktion von kurzlebigen Kunststoffverpackungen in Höhe von zwei Millionen Tonnen. Ähnlich verhält es sich mit anderen biogenen Kunst- und Werkstoffen: Es gibt sie, aber ihr Anteil verlässt bislang selten den einstelligen Prozentbereich.
Effektiver als der Bottom-up-Ansatz ist der Top-down-Ansatz, der die eingesetzte Biomasse möglichst abfallfrei verwertet und deshalb komplett neue Anlagen erfordert. Der erste große Testlauf einer solchen Bioraffinerie in Deutschland soll in Leuna stattfinden. Für 50 Millionen Euro entsteht dort das Chemisch-Biotechnologische Prozesszentrum. 23 Industrieunternehmen sowie 15 Universitäten und Forschungseinrichtungen wollen dort forschen. Ihr Ziel ist es, die Prozesse vom Rohstoff über den Biokatalysator und der Skalierung der benötigten Verfahren zum gewünschten Produkt und in die industrielle Umsetzung zu bringen. Die Firmen Linde und Südchemie planen eigene Demonstrationsanlagen.
Die Ökobilanz der Bioraffinerien ist kaum untersucht
Unklar ist bislang die Ökobilanz der unterschiedlichen Verfahren. Problematisch könnte sie dort werden, wo die Endprodukte keine Stoffe der Petrochemie ersetzen. Muss beispielsweise für die Herstellung von Futterpellets erst Grüngut getrocknet werden, erfordert das mehr Energieaufwand als Sojaschrot zu verfüttern – ein Abfallprodukt der Sojaölpressung. Gut sieht es hingegen dort aus, wo relativ wenig fossile Energie eingesetzt wird, um die nachwachsenden Rohstoffe herzustellen und zu verarbeiten. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn aus Stroh Ethylen, Gips, Eiweiße und Gärreste gebildet werden. Je vollständiger die Bioraffinerie die Pflanzen verarbeitet, desto wirtschaftlicher und umweltfreundlicher ist das Verfahren.
Als das Büro für Technik-Folgenabschätzung 2007 Bioraffineriekonzepte bewertete, blieb als ein Kernergebnis, dass klare Zeit- und Zielvorgaben für die stoffliche Nutzung von Biomasse hilfreich wären. Dieser Forderung ist die Bundesregierung nachgekommen, indem sie im August 2009 den Aktionsplan zur stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe verabschiedete. Bereits seit April 2009 gibt es zudem den Nationalen Biomasseaktionsplan zur energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe.
Aktionsplan zur stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe
2007 waren demnach 2,7 Millionen Tonnen – immerhin 13 Prozent – der Rohstoffe der chemischen Industrie nachwachsenden Ursprungs. Mehr als die Hälfte davon stammt aus dem Ausland. Von den in Deutschland für nachwachsende Rohstoffe genutzten 2,1 Millionen Hektar dienen bislang rund 280.000 Hektar der stofflichen Nutzung. Da diese Ackerflächen auch für Nahrungsmittel genutzt werden könnten, kommt der Kaskadennutzung, also der schrittweisen, möglichst vollständigen Verwertung, eine besondere Bedeutung zu. Denn auch landwirtschaftliche Nebenprodukte, Reststoffe und biogene Abfälle lassen sich chemisch wie energetisch nutzen. Gleiches gilt für Algen aus Aquakulturen und Holz. Die deutschen Waldholzvorräte sind mit 3,4 Milliarden Kubikmetern die größten in Europa.
Zwölf Aktionsfelder benennt der Aktionsplan, auf denen sich in den nächsten Jahren aufgrund der Förderung durch die Bundesregierung einiges bewegen soll, von biobasierten Werkstoffen bis zu Kosmetika. Denn, so das Fazit des Aktionsplans: „Die stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe ist ein wichtiges Element einer nachhaltigen Rohstoffversorgung und trägt dazu bei, die Vorteile einer biobasierten Wirtschaft in Deutschland zu nutzen.“
Nachteil der uneinheitlichen Rohstoffe
Einen großen Nachteil haben Bioraffinierien jedoch gegenüber der Petrochemie: Öl aus ein und derselben Quelle setzt sich immer nahezu gleich zusammen. Pflanzliche Rohstoffe haben hingegen je nach Herkunft und Erntesaison eine unterschiedliche Mengenverteilung ihrer Inhaltsstoffe. Während die chemische Industrie an einem Bioraffineriekonzept mit umfassender Kaskadennutzung forscht, arbeitet die Pflanzenforschung deshalb daran, optimierte Pflanzen bereitzustellen.
Wichtige Grundlagen dafür soll das transnationale Programm PLANT KBBE legen. Der Verbund analysiert von 2008 bis 2013 Pflanzengenome gezielt mit Blick auf die stofflich-industrielle Nutzung. Einen Überblick über die Einzelprojekte bietet die GABI-Website.
Weiter ist die Firma BASF Plant Science mit der transgenen Kartoffel Amflora. In Deutschland werden jährlich 800.000 Tonnen Kartoffel-, Weizen- oder Maisstärke produziert. Diese Stärke ist nicht einheitlich. So gibt es in Kartoffeln normalerweise zwei Typen Stärke: Amylopektin und Amylose. Je nach industrieller Anwendung kann nur einer der beiden Typen genutzt werden. Die Kartoffel Amflora enthält deshalb fast ausschließlich Amylopektin. Erreicht haben die Züchter das, indem sie genetisch das Enzym ausschalteten, das erforderlich ist, um Amylose zu bilden. Die EU-Zulassung von Amflora zieht sich jedoch seit Jahren in die Länge. Freisetzungsversuche und Sicherheitsbewertungen wurden längst abgeschlossen, der kommerzielle Anbau für 2007 erwartet. Da die EU-Agrarminister keine einheitliche Position zu gentechnisch veränderten Pflanzen haben, kam für die Zulassung keine qualifizierte Mehrheit zustande. Der nun zuständige EU-Umweltkommissar zögert die Entscheidung bislang weiter hinaus.
Der Forschungsbedarf ist noch groß
Für die Kaskadennutzung optimierte Pflanzen sind daher noch Mangelware. Dabei kann neben der strittigen Gentechnik auch die klassische Pflanzenzüchtung optimierte Pflanzen liefern – sowohl über Genomanalysen als auch über die gezielte Nutzung der Biodiversität mit Methoden wie dem SMART Breeding. Weil mit optimierten Pflanzen die Effizienz von Bioraffinerien maßgeblich gesteigert werden kann, sind Forschung und Politik gefragt, aufs Tempo zu drücken. Sonst besteht die Gefahr, dass die Fortschritte auf Seiten der Pflanzenzüchter hinter denen der Biotechnologie in der Prozesstechnik noch weiter zurück fallen.
Das Interesse der Industrie am Bioraffineriekonzept liegt übrigens – anders als in Energie- und Verkehrssektor – weniger in den schwindenden Erdölvorräten begründet; zu gering sind die benötigten Ölmengen im Vergleich. Viel mehr sind es Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsaspekte, die Bioraffinerien attraktiv machen sowie die Chance, über die neuen Synthesewege neuartige Materialien zu erzeugen. Dass die Prozesse bislang nur vereinzelt wirtschaftlich sind, wird sich mittelfristig ändern: Die Bioraffineriekonzepte werden ausgereifter, die Pflanzen geeigneter – und das Öl teurer.
Titelbild: Aus Raps lässt sich weit mehr als nur Speiseöl gewinnen. (Quelle: © Petra Schmidt / pixelio.de)