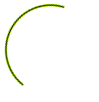Phosphatdüngung ohne Zukunft?

(Quelle: © iStockphoto.com/ Jeffrey Heyden-Kaye)
Phosphor spielt eine zentrale Rolle im Stoffwechsel aller Lebewesen. Für Pflanzen ist er in Form von Phosphaten zu einem wichtigen Dünger geworden. Doch die Phosphatvorräte der Erde gehen zur Neige. Gelingt es der Pflanzenforschung, diesem Problem zu begegnen?
Ohne das chemische Element Phosphor wäre Leben, wie wir es kennen, nicht möglich. Als Adenosintriphosphat (ATP) versorgt es Zellen mit Energie. Es ist Bestandteil der Erbinformationen und kann als Phosphatgruppe steuern, ob bestimmte Proteine in der Zelle aktiv oder inaktiv sind. Für den Menschen ist Phosphor zusammen mit Kalzium wesentlich für den Knochenaufbau.
Limitierender Faktor für das Pflanzenwachstum
Auch das Grundgerüst von Pflanzen benötigt in den Lipiden Phosphor. Darüber hinaus beeinflusst Phosphor die Photosynthese sowie den Kohlenhydrat- und den Wasserhaushalt. Bei Phosphormangel verringert sich die Blattfläche, und die Blätter versteifen sich, weil sich in den Chloroplasten Stärke ansammelt. Da die Bildung von Chlorophyll nicht so stark abnimmt wie die Blattfläche, färben sich die Blätter dunkelgrün. Darüber hinaus sterben viele Zellen ab, und die Pflanze produziert Blüten, Samen sowie Früchte verringert oder verspätet. Einige Pflanzen verstärken ihr Wurzelwachstum auf der Suche nach Phosphor, andere ersetzen in ihren Zellmembranen Phospholipide durch kohlenhydrathaltige Glykolipide. So ist der Phosphor für andere Zellprozesse verfügbar. Obwohl Pflanzen nur relativ geringe Mengen Phosphor benötigen, ist das Element deshalb ein limitierender Faktor für das Wachstum. In der Landwirtschaft wird darum phosphathaltiger Dünger eingesetzt. Um einem Mangel vorzubeugen, speichern Pflanzen Phosphorüberschüsse als Säure Phytat in ihren Vakuolen.
Phosphat aus organischen und anorganischen Quellen
Um Phosphat verwerten zu können, müssen Pflanzen es aus organischen oder anorganischen Quellen freisetzen und in Dihydrogenphosphat (H2PO4) umwandeln. Dazu scheiden sie organische Säuren und Enzyme ab und produzieren verstärkt Phosphattransporter. Häufig sind diese Prozesse jedoch nur bei Phosphatmangel aktiv. Unterstützt werden sie von Pilzen und Mikroorganismen, deren Enzyme die gleiche Umwandlung vornehmen.
Die älteste Quelle für Phosphatdünger ist Guano. Guano entsteht aus Vogeldung, der vom Regen auslaugt wird. Das Wasser samt der ausgespülten Stoffe sickert auf Kalksand und bildet dort eine stickstoff- und phosphorhaltige Schicht. Die größten Vorkommen gab es an den Küsten Südamerikas. Obwohl neue chemische Verfahren Anfang des 20. Jahrhunderts günstige Alternativen geschaffen haben, gilt Guano heute als weitgehend aufgebraucht. Als organische Phosphatquelle kommen deshalb häufig tierische Exkremente wie Gülle zum Einsatz. Eine weitere organische Variante sind Lupinen als Zwischenfrucht. Sie befördern mit ihren tiefen Wurzeln Phosphate in die oberen Schichten, wo andere Pflanzen diese nutzen können.
Für mineralische Phosphatdünger bilden metallarme Rohphosphate die Grundlage. Die Rohphosphate, meist Kalziumphosphate, werden mit Phosphor- oder Schwefelsäure zu Kalziumdihydrogenphosphat umgewandelt. Das mit Schwefelsäure aufgeschlossene Phosphat wird als Superphosphat bezeichnet, und enthält etwa 60 Prozent Kalziumsulfat. Das mit Phosphorsäure aufgeschlossene Produkt heißt Doppelsuperphosphat, ist frei von Kalziumsulfat und hat einen besonders hohen Phosphatanteil.
Rohphosphate existieren vorwiegend im nördlichen und südlichen Afrika, in Florida, Russland und China. Experten schätzen, dass diese Vorkommen nur noch etwa 50 bis 60 Jahre reichen werden. Hinzu kommt, dass viele Vorkommen mit Kadmium oder radioaktiven Schwermetallen belastet sind. Weltweit unterschreitet nur noch eine Quelle die Grenzwerte der Europäischen Union. Verschärft wird die Knappheit dadurch, dass Phosphate nicht nur als Dünger genutzt werden. Sie kommen ebenso zum Einsatz in Waschmitteln, als Flamm- und als Korrosionsschutz sowie als Zusatz in Lebens- und Futtermitteln.
Mykorrhiza – Gemeinschaft aus Pflanze und Pilz
Eine ganz andere Quelle der pflanzlichen Phosphatversorgung ist deshalb die Hoffnung vieler Landwirte: Pilze, die im Wurzelraum der Pflanzen leben und mit diesen eine Zweckgemeinschaft (Symbiose) eingehen. Biologen sprechen von dieser Gemeinschaft als Mykorrhiza. Die Pilze wachsen an den Feinwurzeln der Pflanzen, schützen sie vor manchen Wurzelschädlingen und versorgen die Pflanzen mit Wasser sowie Nährsalzen, darunter Phosphat. Wachstum und Dürretoleranz der Pflanzen steigen durch die Symbionten deutlich. Im Ausgleich geben die Pflanzen bis zu einem Viertel der von ihnen gebildeten Stoffwechselprodukte an die Pilze ab.
Mykorrhizien werden grob in drei Gruppen unterteilt: Die Ektomykorrhiza, die vor allem Bäume betrifft, die Endomykorrhiza, die häufig bei Heidekraut-, Wintergrüngewächsen und Orchideen vorkommt, sowie die arbuskuläre Mykorrhiza, die bei vielen Nutzpflanzen die Phosphatversorgung verbessert.
Die arbuskuläre Mykorrhiza existiert bereits seit 420 Millionen Jahren, was der Grund sein dürfte, dass über 80 Prozent aller Pflanzen zu dieser Art der Symbiose fähig sind. Auf der Gegenseite gibt es jedoch nur eine Gruppe Pilze, die als Symbionten in Frage kommt: so genannte Glomeromycetes. Die Hyphen dieser Pilze dringen in die Wurzeln und sogar in die Wurzelzellen ein, wo der Austausch der Nährstoffe erfolgt. Bakterien unterstützen die Pilze darin, Phosphatmineralien so aufzulösen, dass die Pflanzen das Phosphat nutzen können.
Mykorrhizasymbiosen in der Praxis
Landwirte und Pflanzenforscher haben deshalb schon lange ein Auge auf diese Symbiose geworfen und nutzen sie, um Erträge zu steigern. Zudem erhöhen Mykorrhizakulturen die Überlebenschancen junger Setzlinge, die per Mikropropagation hochgezogen wurden. Entsprechende Kulturen gibt es sogar für den privaten Gartenbedarf zu kaufen. Selbst erwachsenen Pflanzen in Garten und Blumentopf sollen Mykorrhizapilze helfen. Dieser Erfolg ist allerdings umstritten, da Pilze als Lebewesen schwieriger anzuwenden sind als Chemikalien.
Gerade die naturnahe Landwirtschaft setzt stark auf die Mykhorriza, um auf größere Mengen Dünger und Pestizide zu verzichten. Mineralische Dünger wären hier auch kontraproduktiv, weil diese die Symbiose schädigen, da der Phosphatüberschuss für die Pflanzen die Symbiose überflüssig macht. Bei Fruchtfolgen sollten Landwirte zudem darauf achten, keine Sorte zu nutzen, die nicht zur Mykorrhizasymbiose fähig ist. Sonst muss sich die Pilzpopulation bei der nächsten mykorrhizafähigen Pflanze erst wieder erholen. Bislang findet dieser Umstand noch wenig Beachtung. Weil die Mykorrhiza den Stress der Pflanze mindert, hilft sie auch, wenn verödete Flächen in aufgelassenen Tagebau- oder Minengebieten zurückgewonnen werden sollen.
Forschung für eine bessere Phosphatversorgung
Ein besseres Verständnis von der Abläufen in der Symbiose ist deshalb ein zentrales Ziel der Pflanzenforschung. Dass die Pilze vor Pflanzenschädlingen schützen, ist beispielsweise sicher. Wie sie das machen, bleibt bislang jedoch ein Rätsel. Schwierig werden diese Untersuchungen dadurch, dass die Pilze zum einen aus einer Vielzahl genetisch unterschiedlicher Individuen bestehen und sich unter der Hand der Forscher verändern können. Zum anderen lassen sich die Pilze nicht isoliert züchten, sondern können nur in pflanzlicher Symbiose überleben.
Besser verstanden als die Mykorrhiza selbst ist inzwischen, wie das Phosphat von den Pilzen in die Pflanze gelangt. Forscher der ETH Zürich konnten bereits im Jahr 2001 das Gen identifizieren, dass für die Phosphataufnahme in der mykorrhifizierten Wurzel verantwortlich ist. 2007 konnten die Forscher zusammen mit anderen Pflanzenforschern anderer Institute erklären, was dieses Gen in pilzbewachsenen Wurzeln aktiviert. Es ist Lysophosphatidylcholin, eine Substanz, die entsteht, wenn aus der Zellmembran Phosphatidylcholin abgebaut wird.
Noch genereller war der Ansatz von Forschern am Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie in Golm. Sie analysierten 2008 den Phosphatstoffwechsel der Ackerschmalwand und fanden ein molekulares Signal, dass bei Phosphatmangel aktiv wird. Dabei handelt es sich um die mikroRNA miR399. In den Wurzeln deaktiviert dieses Molekül das Gen PHO2, wodurch sich die Phosphataufnahme aus dem Boden und der Phosphattransport erhöhen. Eine effizientere Phosphataufnahme – ob aus dem Boden oder über die Mykorrhiza – könnte für viele Pflanzen den Bedarf an Phosphatdüngern reduzieren, teilweise bis auf Null.
Ein ganz anderes Ziel verfolgen einige Pflanzenzüchter, die mittels Gentechnik Mais dazu bringen wollen, das Enzym Phythase zu bilden. Das spaltet den Phosphor von der Säure Phytat ab, die die Pflanzen in ihren Vakuolen eingelagert haben. Profiteur ist die Viehzucht: Wiederkäuer können auf diese Weise den Phosphor im Futtermais nutzen, um Eiweiße zu bilden. Bislang müssen Phytasen dem Futter beigemischt werden.
Umweltauswirkungen der Phosphatdüngung
So wichtig die Phosphatdüngung für den Ertrag der Pflanzen ist, so problematisch kann sie auch für die Umwelt sein. Vor allem bei unsachgemäßer Düngung mit Gülle oder Jauche können durch Regen größere Mengen Phosphat ausgespült werden und in Gewässer gelangen. Aber auch die Erosion transportiert Phosphate, gebunden an Tonminerale, in Oberflächengewässer. Dort steigert der Nährstoff das Wachstum von Algen und Wasserpflanzen. Deren Absterben verursacht letztlich einen Sauerstoffmangel und die Bildung von Giftstoffen – und damit ein Fischsterben.
Sowohl dieser ökologische Aspekt als auch die Knappheit des Rohstoffs führen dazu, dass immer mehr Kläranlagen Phosphate aus dem Klärwasser zurückgewinnen. Zusammen mit den Fortschritten der Pflanzenforschung besteht deshalb die Hoffnung, dass Landwirte auch in 60 Jahren ihre Pflanzen noch mit Phosphaten versorgen können werden. Bewältigt ist diese Herausforderung jedoch noch nicht.