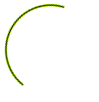Das Erbe der Riesen
Große Pflanzenfresser ebneten den Weg zur Domestikation von Pflanzen

Moschusochse: Einer der zahlreichen Pflanzenfresser, die im Gehege des Pleistozän-Parks (Russland) umherstreifen. Dort wird getesten, ob große Pflanzenfresser üppige pleistozäne Graslandökosysteme wiederherstellen können. (Bildquelle: © Frank Kienast)
Viele erwünschte Eigenschaften unserer Nutzpflanzen haben sich schon entwickelt, als der Mensch noch keinen Ackerbau betrieb. Sie sind vermutlich Anpassungen an die Megafauna der eiszeitlichen Steppen.
Wie haben sich unsere Nutzpflanzen entwickelt? Möglicherweise waren es nicht (nur) äußere Faktoren wie Klimaveränderungen oder Nahrungsmangel, die den Menschen dazu veranlassten, Pflanzen anzubauen. Vielmehr gab es bereits einige Pflanzenarten, die ohne Zutun des Menschen einige Nutzpflanzeneigenschaften entwickelt hatten – erworben über Jahrtausende durch das „Zusammenleben“ mit großen Pflanzenfressern. In einem Review geht ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung des Max-Planck-Institutes für Menschheitsgeschichte in Jena diesen frühen Anfängen der erfolgreichen „Zusammenarbeit“ zwischen Pflanze, Tier und Mensch auf den Grund.

Waldbison im Ust'-Buotama Bison-Park (Russland). 2006 wurden 35 Waldbisons aus Kanada eingeführt. Diese Megaherbivoren haben sich an die lokale Umgebung angepasst und ihre Population vergrößert. Das 100 Hektar große Gehege dient als Studienort für Ökologen/Zoologen. Es bietet die Möglichkeit, Veränderungen in der Vegetation in Verbindung mit dem Selektionsdruck der Pflanzenfresser zu verfolgen.
Bildquelle: © Frank Kienast
Massenaussterben vor etwa 12.000 Jahren
Vor etwa 12.000 Jahren am Übergang vom Jungpleistozän zum Holozän, unserer heutigen Zeit, gab es ein Massenaussterben. Insbesondere waren davon sehr große Säugetiere wie Wollmammut, Wollnashorn, Steppenbison und Riesenhirsch betroffen, die damals auch in Europa heimisch waren. Als Ursache vermuten Forscher:innen Klimaveränderungen, aber auch das Vorrücken des Menschen.
Diese großen Tiere hatten zu ihrer „Blütezeit“ die von ihnen bewohnten Ökosysteme stark geprägt. Vor allem die grasenden Pflanzenfresser sorgten für ausgedehnte Graslandschaften, indem sie Waldaufwuchs verhinderten und mit ihren Hufen die Erde umpflügten. Aber auch im Wald sorgten große Tiere für „Ordnung“. Sie fraßen den Unterwuchs und verringerten damit die Gefahr von ausgedehnten Bränden.
Friss mich!
Viele Pflanzen, die in dieser Zeit in den betreffenden Ökosystemen lebten, passten sich den grasenden Riesen an. Diese Anpassungen begannen vermutlich bereits seit dem Eozän vor 56 Millionen Jahren. Die Forscher:innen vermuten, dass besonders einjährige Gräser (Poaceae, Cyperaceae) und Hülsenfrüchtler (Fabaceae) durch spezielle Anpassungen von der sogenannten Megafauna profitierten. Sie änderten ihre Lebensweise, waren nun schnellwachsend mit einem einjährigen Lebenszyklus und fähig zur Selbstbefruchtung.
Auch die Verbreitungsstrategie für die Samen revolutionierten sie. Dazu entwickelten die Pflanzen Samenstände mit vielen kleinen Samen, die an der Spitze der Pflanze wuchsen. Das erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass sie von den Tieren abgefressen und mit dem Kot später wieder an anderer Stelle ausgeschieden wurden. Die Samen der Gräser lösten sich auch nicht mehr selbst von der Ährenachse, sondern saßen fest. Das verhinderte, dass Samen „nutzlos“ zu Boden fallen und dann nicht mehr von den Tieren aufgenommen werden können.

Die Pflanzen, die auf beiden Seiten dieses Bisonpfades wachsen, sich hauptsächlich „kleine Gerste“, eine der nordamerikanischen „Lost Crops“. Das Foto wurde bei einer Feldstudie aufgenommen. Dabei wurde untersucht, welche Rolle Bisons für die Evolution der Vorläufer bestimmter alter Kulturpflanzen gespielt haben könnten.
Bildquelle: © Natalie Mueller
Damit die Samen den Verdauungstrakt der Tiere unbeschadet wieder verlassen können, wurden die Samenschalen widerstandsfähig gegen die Verdauungssäfte. Zusätzlich verlängerte sich die Phase der Dormanz, um zeitgerecht keimfähig zu sein. Schließlich verzichteten diese Pflanzenarten auf giftige Stoffe und Dornen, um weidende Tiere nicht abzuschrecken. Viele dieser speziellen Eigenschaften wirkten sich später günstig auf eine Domestizierung durch den Menschen aus, folgerte das Forschungsteam.
Ohne Tiere nix los
Die Tiere sorgten im Gegenzug für genug Licht und Dünger und Samenverteilung – oft in weit entfernte Regionen, die sie durch ihre Wanderungen erreichten. Dadurch war ein genetischer Austausch zwischen den einzelnen Pflanzenpopulationen gesichert. Die ausgeschiedenen Samen konnten im immer wieder aufgerissenen und gedüngten Boden gut keimen. Ähnlich verhielt es sich mit einigen Baumarten: Sie boten den großen Pflanzenfressern saftige, fleischige oder süß schmeckende „Megafrüchte“ an. Diese Früchte waren zu groß, um von Vögeln gefressen zu werden. Sie waren für die vierbeinigen Früchtefresser und ihre „Verteilungsstrategie“ bestimmt.
Alles prima also, bis die meisten der großen Pflanzenfresser vor etwa 12.000 Jahren in relativ kurzer Zeit verschwanden. Das stellte die Pflanzen vor massive Probleme, denn ohne ihre „tierischen Partner“ gab es kaum noch effektive Samenverbreitung und nur noch einen verringerten genetischen Austausch. Dadurch waren viele Populationen, besonders oft Baumarten, auf einmal isoliert. Kleinere Pflanzenfresser, die von der Aussterbewelle kaum betroffen waren, konnten die ökologische Lücke der Megafauna bei weitem nicht ausfüllen. Die Graslandschaften wuchsen zu, der Boden wurde hart und die Samenkeimung war erschwert.
Der Mensch als Ökosystem-Dienstleister
In diese Lücke stieß Anfang des Holozäns der moderne Mensch als Ersatzpartner. Von den ehemals an die Megafauna angepassten Pflanzenarten tauchten nun einige in der Nähe des Menschen auf, vor allem die anpassungsfähigen einjährigen Arten. Denn in der Umgebung von Siedlungen war der Boden ebenfalls offen, es gab Licht, Stickstoff und Wasser. Aber auch Früchte von Bäumen wurden von den Menschen gesammelt, über weite Strecken transportiert und gegessen. Auf diese Weise konnten isolierte Populationen verschiedener Baumarten wieder in „genetische Verbindung“ treten.
Mit dem beginnenden Ackerbau vor etwa 10.000 Jahren verstärkte sich dieser Trend: Der Mensch begann, aktiv nach Pflanzen zu suchen, die er kultivieren konnte. Da boten sich natürlich jene Pflanzenarten an, die bereits durch das Zusammenleben mit der Megafauna „anthropophile“ Anpassungen vollzogen hatten. Und der Mensch verhielt sich ähnlich wie die großen Tiere: Der Boden wurde regelmäßig durch die Hacke und später den Pflug gelockert, grasende Haustiere hielten den Bewuchs kurz und sorgten für Dünger, schnellwachsende Pflanzen wurden gesät, gedüngt und geerntet. Saatgut wurde transportiert oder für das nächste Jahr aufbewahrt, später zusätzlich noch durch Kreuzungen verbessert.

Passend zum Thema: Unser Plantainment-Special „Tierisch gute Freunde - Oder eine Zweckgemeinschaft?“
Lange Entwicklung
Dem Forschungsteam zufolge ist es daher nicht verwunderlich, dass Arten aus bestimmten Pflanzenfamilien, die sich schon gut mit den großen Tieren „verstanden“ und sich an sie angepasst hatten, heute den größten Teil der Nutzpflanzen stellen. Dazu zählen die Süßgräser (Poaceae), die Kreuzblütler (Brassicaceae), die Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae), die Rosengewächse (Rosaceae), die Hülsenfrüchtler (Fabaceae) oder die Nachtschattengewächse (Solanaceae). Und: Ihre Domestikation fand unabhängig voneinander in verschiedenen Teilen der Welt statt.
Das Forschungsteam vermutet daher, dass viele Eigenschaften der ersten Nutzpflanzen durch das enge Verhältnis mit der Megafauna und nicht erst durch menschliches Zutun entstanden sind. Sie erwarten neue Erkenntnisse zur Domestikation von Nutzpflanzen daher auch nicht aus dem Labor oder durch Ausgrabungen, sondern aus wiederhergestellten Landschaften, in denen große, grasende Pflanzenfresser leben. Denn ihrer Meinung nach seien wichtige Phasen des Domestikationsprozess als evolutive Schritte zu betrachten. So ist wohl die Rolle des Menschen bei der Domestikation seiner Nutzpflanzen zumindest kleiner als gedacht.
Quelle:
Spengler, R.N. et al. (2021): Exaptation Traits for Megafaunal Mutualisms as a Factor in Plant Domestication. In: Frontiers in Plant Science, Vol 12, (24. März 2021), doi: 10.3389/fpls.2021.649394.
Zum Weiterlesen:
- Jäger des noch nicht verlorenen Schatzes - Wo gibt es noch die wilden Verwandten unserer Nutzpflanzen?
- Totgesagte leben länger - Forscher testen längst vergessene Nutzpflanzen im Anbau
- Inventur der Ahnen - Zum Schutz von wilden Genen
- Fahrplan zur Langlebigkeit - Mehrjährige Getreide könnten die Umweltbilanz der Landwirtschaft verbessern
Titelbild: Moschusochse (Ovibos moschatus) – einer der zahlreichen Pflanzenfresser, die im Gehege des Pleistozän-Parks, einem Naturschutzgebiet im Norden der Republik Sacha (Russland), umherstreifen. Dieses fortlaufende Beweidungsexperiment begann 1988 und hat zum Ziel, zu testen, ob große Pflanzenfresser üppige pleistozäne Graslandökosysteme wiederherstellen können. (Bildquelle: © Frank Kienast, Senckenberg, Weimar)