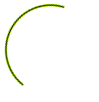Regionale Lebensmittel
Könnte Berlin sich selbst versorgen?

Lassen sich Großstädte wie Berlin überwiegend regional versorgen? Prinzipiell ja, sagen Ernährungs- und Agrarwissenschaftler der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. (Bildquelle: © laleyla5/pixabay, CCO)
Hochbeete inmitten von Brachflächen, Gemeinschaftsgärten und blühende Verkehrsinseln – schon seit Jahren wird in Städten immer mehr ausgesät und angebaut. Aber könnte sich eine Großstadt wie Berlin mit den Flächen des Umlandes tatsächlich auch versorgen? Zu guten Teilen, meinen Agrarwissenschaftler in einer aktuellen Studie.
„Wir wollten herausfinden, welche Flächenkapazitäten da wären, um Berlin mit regionalen Produkten zu versorgen“, erklärt Susanna Hönle, Erstautorin der Studie. „Und wir wollten wissen, ob das dazu passt, was von Ernährungsseite beansprucht wird.“
Viele Produkte aus Deutschland

In Berlin wird viel Schweinefleisch konsumiert. Doch die Produktion davon ist besonders flächenintensiv.
Bildquelle: © aitoff/ pixabay/ CC0
Um die Möglichkeiten der Selbstversorgung in der Hauptstadt auszuloten, ging das Forschungsteam in zwei Schritten vor. Zunächst nahmen sie die Essgewohnheiten der Hauptstädter in Augenschein. Über die Herkunft der Lebensmittel, die sie konsumieren, konnten sie den Grad der Selbstversorgung Berlins mit inländischen Produkten bestimmen. Im nächsten Schritt berechneten sie, ob die landwirtschaftlichen Nutzflächen des Brandenburger Umlands ausreichen würden, um das Angebot bereitzustellen, mit dem sich der Bedarf der Berliner Bevölkerung decken ließe.
„72 Prozent der Fläche, die tatsächlich für den Lebensmittelkonsum der Berliner gebraucht werden, liegen in Deutschland“, berichtet Autorin Hönle. „Mit Ausnahme von Produkten wie Obst oder Wein könnte sogar vieles davon regional in Brandenburg erzeugt werden.“ Mit 28 Prozent liegt ein knappes Drittel der für den Konsum erforderlichen Fläche im Ausland.
Schweinezucht besonders flächenintensiv
Von den Lebensmitteln, die die Berliner verzehren, nimmt Schweinefleisch die insgesamt größte Fläche in Anspruch – die Produktion von Käse beispielsweise ist zwar ähnlich flächenintensiv, es wird in der Hauptstadt aber mehr Schweinefleisch als Käse konsumiert. Die dem Schweinfleisch folgenden größten landwirtschaftlichen Flächenbedarfe entfallen auf die Erzeugung von Rindfleisch, Getreide und Käse.
Um den Bedarf an Lebensmitteln zu decken, ist pro Person eine Fläche von 2.374 Quadratmetern (0,237 Hektar) erforderlich. Multipliziert mit der Einwohnerzahl der Hauptstadt, bedarf es für die Versorgung Berlins einer Fläche von 821.433 Hektar, wie die Wissenschaftler berechnet haben. Zum Vergleich: Die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche in Deutschland beträgt 16,7 Millionen Hektar. Geteilt mit der Gesamteinwohnerzahl von 80,2 Millionen, ergibt sich eine Fläche von 0,207 Hektar pro Kopf der Bevölkerung. Was bedeutet das für die Möglichkeiten der Selbstversorgung?
Vergleich mit Brandenburgs Fläche
Der Vergleich des Berliner Bedarfs mit den Ackerböden und dem Weideland Brandenburgs zeigt: „Gäbe es keine Verschwendung, würde die Fläche ausreichen, um die Berliner zu ernähren“, fasst die Agrarwissenschaftlerin Susanna Hönle zusammen. „Zumindest wäre es dann möglich, die Handelsbilanz ausgeglichen zu halten und nicht mehr Flächen zu importieren als zu exportieren.“ Ihre wichtigste Schlussfolgerung lautet deshalb, weniger Essen wegzuwerfen.

Zu viele Lebensmittel wandern in den Müll.
Bildquelle: © Maaark/ pixabay/ CC0
In Deutschland landen jedes Jahr schätzungsweise 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall; Hersteller, Händler, Landwirte und Verbraucher entsorgen Essen im Müll. Oft wäre es noch genießbar, wird aber aus anderen Gründen entsorgt – etwa, weil die Salatblätter schlapp geworden sind oder die Gurke zu krumm ist (die berühmte EU-Verordnung zur Krümmung von Gurken ist zwar abgeschafft, aber der Handel zieht gerade Gurken noch immer vor, weil sie sich besser verpacken lassen).
Zwischen Geringschätzung und Überhöhung
Verschwendung – ein Zeichen von Geringschätzung? Die Verbraucherzentrale macht für die massenhafte Entsorgung von Essen im Müll den Preisverfall der Produkte verantwortlich. Denn während die Ausgaben für Nahrungsmittel 1950 noch bei 50 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens gelegen hätten, beliefen sie sich heute auf lediglich 9,5 Prozent. So argumentiert, trifft auf Lebensmittel zu, was auch für andere Lebensbereiche gilt: Was nichts kostet, ist nichts wert.
Dass Nahrungsmittel in westlichen Gesellschaften vielfach als selbstverständlich hingenommen werden und Ernährung einen eher beiläufigen Charakter hat, ist eine Seite der Medaille. Zugleich – und sicherlich als Reaktion auf die Gepflogenheiten der Konsum- und Überflussgesellschaft – gibt es gesellschaftliche Milieus, in denen der Ernährung eine entscheidende und bisweilen sogar quasi-religiöse Bedeutung zukommt. Hier übt man sich in Verzicht – auf Fleisch, auf sämtliche tierische Produkte, auf Industrienahrung, auf Kohlenhydrate, auf Gluten oder auf Laktose.
Befragungen belegen immer wieder, dass das Bewusstsein für die Qualität von Lebensmitteln in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Insbesondere regional erzeugte Produkte gewinnen an Beliebtheit.
Produkte aus dem nahen Umland
Auch in Großstädten, wo es kaum oder keine landwirtschaftlichen Flächen gibt, ist die Versorgung mit regionalen Gütern ein Thema. Zu den Initiativen, in deren Zentrum regionale Güter stehen, gehört beispielsweise CSA, „Community Supported Agriculture“. Hier verpflichten sich Mitglieder, die oftmals in der Stadt wohnen, für die Dauer eines Jahres einen monatlichen Betrag zu entrichten. So finanzieren sie gemeinsam die Bewirtschaftung eines Hofs während eines Jahres – und erhalten im Gegenzug dessen Erzeugnisse.

Viele der in Berlin konsumierten Agrarprodukte könnte regional in Brandenburg produziert werden.
Bildquelle: © CeHa/Fotolia.com
Anders als beispielsweise bei Gemüsekisten ist es aber keine festgelegte Menge, die Mitglieder im Gegenzug beziehen. Sie erhalten, was der Hof abwirft. Dabei ist das Risiko von Missernten auf den Schultern aller Mitglieder verteilt; die Gemeinschaft profitiert umgekehrt als Ganze, wenn beispielsweise die Pflaumenernte besonders üppig ausfällt. Auch wenn Wirtschaftsgemeinschaften wie diese deutschlandweit eine Seltenheit sind, so stellen sie doch eine Möglichkeit dar, die Grundversorgung mit Lebensmitteln aus der Region zu decken. Der Buschberghof war der bundesweit erste Hof, der sich über die solidarische Landwirtschaft finanzierte. Mit Obst, Gemüse und Getreide, mit Milchprodukten, Käse und Fleisch ernährt er heute rund 300 Mitglieder, die mehrheitlich in der Elbmetropole Hamburg leben. Dieses Beispiel zeigt, dass auch das Stadtleben mit Bezug zum ländlichen Raum einhergehen kann.
Pflanzenwachstum in der Stadt
Auch die Stadt selbst wird zunehmend als Raum entdeckt, in dem sich Landwirtschaft betreiben lässt. Architekten arbeiten daran, dies aufgrund der Platzverhältnisse in die Vertikale zu verlagern. Auf dem Berliner Euref-Campus beispielsweise wurde im Herbst 2015 eine Algenzuchtanlage auf der Gebäudefassade installiert – den Betreibern zufolge ist es die weltweit erste Anlage dieser Art im innerstädtischen Raum. Was aussieht wie eine Lamellenjalousie ist eine Vorrichtung aus Röhren, in denen Mikroalgen wachsen, die zur Erntezeit auf den Tellern der hauseigenen Kantine landen.
Mit ihren Proteinen, Vitaminen und Omega-3-Fettsäuren könnten sie, so das Argument der Initiatoren, künftig eine Antwort auf Bevölkerungswachstum, Verstädterung und Ernteausfälle durch den Klimawandel liefern.
Damit sind zentrale und globale Herausforderungen der Zukunft zumindest schon einmal benannt. Was spricht dagegen, die Landwirtschaft neu zu erfinden? Auch in ihrer heutigen Form wurde sie schließlich vom Menschen erdacht.
Quelle:
Hönle S.E., Meier T. und Christen O. (2017): Land use and regional supply capacities of urban food patterns: Berlin as an example. In: Ernährungs-Umschau 64(1): 11-19, (13. Januar 2017), doi: 10.4455/eu.2017.003.
Zum Weiterlesen:
- Die Bedeutung regionaler Märkte im Kampf gegen Hunger
- 500 Szenarien für die Ernährung im Jahr 2015
- Gute Nachrichten für die Welternährung
- Wie kann die Weltbevölkerung 2050 ernährt werden?
Titelbild: Lassen sich Großstädte wie Berlin überwiegend regional versorgen? Prinzipiell ja, sagen Ernährungs- und Agrarwissenschaftler der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. (Bildquelle: © laleyla5/pixabay, CCO)