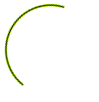Hilfreiches Erbe
Pflanzen geben ihre Umwelterfahrungen an Nachkommen weiter

Beim Brillenschötchen (Biscutella didyma) konnte ein Forschungsteam den parentalen Umwelteffekt nachweisen. (Bildquelle: © Christian Lampei)
Um in wechselhaften Ökosystemen zu überleben, können Pflanzen ihre selbst gemachten Umwelterfahrungen an ihre Nachkommen weitergeben. Dies ist eine individuelle Überlebensstrategie, um sich besser an ihre Umwelt anzupassen – eine, die auch der Art hilft. Doch es ist nur eine von mehreren Strategien.
Pflanzen haben es schwer, wenn sie in Gebieten mit stark variable Umweltbedingungen leben, wie zum Beispiel in ariden Gegenden, in denen die Niederschläge geringer als die Verdunstung und noch dazu unvorhersehbar sind. Das erschwert eine Anpassung und erhöht das Risiko auszusterben. Damit die Population in solchen schwer berechenbaren Umwelten überleben kann, wählen einige Pflanzen eine riskante und kostspielige Strategie: Sie geben den Nachkommen zwar den selben Genotyp, aber unterschiedliche phänotypische Varianten mit. Einige Nachkommen werden dann unter den gegebenen Bedingungen gut gedeihen, andere nicht.

Pflanzen, die in ariden Regionen leben, müssen einen Weg finden, sich an Trockenheit anzupassen.
Bildquelle: © el2ror/Fotolia.com
Auch wenn nur einige Pflänzchen das Licht der Welt erblicken, weil sie die „richtige Ausstattung“ erhalten haben und an die Umweltbedingungen optimal angepasst sind, sichern sie dennoch den Fortbestand der Art. Diese Strategie wird in der Wissenschaft „bet-hedging“ genannt. Im übertragenen Sinne bedeutet es, nicht alle Eier in einen Korb zu legen bzw. nicht alles auf eine Karte zu setzen. Risiken werden durch „bet-hedging“ verteilt und ermöglicht das Überleben der Art.
Ein Beispiel hierfür ist, wenn Pflanzen bei wechselhafter Umgebung Samen mit unterschiedlichen Keimfähigkeiten produzieren. Dies führt dazu, dass Samenbanken im Boden angelegt werden, d. h. einige der produzierten Samen verweilen dort in einem Ruhezustand (Dormanz, bzw. Samenruhe). Das Überleben hat allerdings einen hohen Preis: Diese Strategie geht auf Kosten der (biologischen) Fitness. Denn das Risiko ist hoch, dass Samen im Boden vor der Keimung absterben oder junge Keimlinge noch vor Eintritt in die Reproduktionsphase verkümmern.
Elterliche Erfahrungen helfen den nächsten Generationen
Eine Möglichkeit diese Fitnesskosten zu reduzieren gibt es: Eltern können ihre eigenen Umwelterfahrungen weitergeben. Dieses Phänomen wird auch „parentaler Umwelteffekt“ genannt. Er wird von zwei Faktoren beeinflusst: den klimatischen Bedingungen, denen die Eltern ausgesetzt sind und der Pflanzendichte der nachfolgenden Generation.
Geben Pflanzen ihren Nachkommen die „passenden“ Erfahrungen mit, kommt das nicht nur dem Individuum zugute, sondern auch der Population. Das setzt jedoch voraus, dass die Pflanze die künftigen Umweltbedingungen der Sprösslinge möglichst genau „prognostizieren“.

„Bet-hedging“ ist eine Strategie, um das Überleben der Art zu sichern. Pflanzen produzieren beispielsweise Samen mit unterschiedlichen Keimfähigkeiten, damit einige davon unter den zukünftigen Bedingungen gedeihen können. Im übertragenen Sinne bedeutet es, nicht alles auf eine Karte zu setzen.
Bildquelle: © Alexas_Fotos/ pixabay/ CC0
In wechselhaften Umwelten sorgen die Eltern im oben beschriebenen Beispiel dafür, dass die Samenruhe nach trockenen Perioden reduziert und nach niederschlagsreichen Zeiten erhöht wird. Nach trockenen Zeiten keimen somit mehr Samen aus als nach nassen Phasen, nach denen mehr Samen im Boden verweilen.
Als Grund für dieses Verhalten schlussfolgerten die Forschenden, dass nach einer trockenen Phase die Wahrscheinlichkeit für optimale Lebensbedingungen steigt, weil die Konkurrenz geringer ist. Genauso muss man nach regenreichen Phasen damit rechnen, dass die umgebenden Pflanzen viele Samen produziert haben, was zu einer höheren Pflanzendichte führt. Dies sorgt für eine stärkere Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe und mindert wiederum die Fitness. Soweit die Hypothese. Ob dies tatsächlich so abläuft, wurde in einer aktuellen Studie genauer untersucht.
Im Praxistest bewiesen
Forschende der Universitäten Tübingen und Hohenheim untersuchten diesen Effekt an zwei einjährigen Pflanzenarten. Als Versuchspflanzen dienten Biscutella didyma, ein Kreuzblütler, der auch Brillenschötchen genannt wird und das Gras Bromus fasciculatus. Beide Pflanzenarten leben in den beschriebenen trockenen Ökosystemen.
Für ihre Untersuchungen des parentalen Umwelteffekts nutze das Forschungsteam Pflanzen bzw. Samen von Populationen aus vier unterschiedlichen (klimatischen) Regionen Israels. Die Pflanzen ließen sie unter 12 verschiedenen Bewässerungsintensitäten wachsen. Anschließend wurde die Keimung der von den Pflanzen produzierten Samen verglichen. Auch Daten der jeweiligen Heimatregionen flossen in die Analysen ein. Diese waren zum Beispiel Daten wie Niederschlagsmengen, Samenproduktion oder Pflanzendichte. Berechnungen, wie präzise man von der jährlichen Niederschlagsmenge auf die Pflanzendichte und die Samenproduktion im folgenden Jahr schließen konnte waren so möglich.

Forschende der Universitäten Tübingen und Hohenheim untersuchten den "parentalen Umwelteffekt" an zwei einjährigen Pflanzenarten: dem Kreuzblütler Biscutella didyma und dem Gras Bromus fasciculatus.
Bildquelle: © Christian Lampei
Bei der Pflanze Biscutella didyma konnte bei allen Populationen ein parentaler Umwelteffekt belegt werden. Dieser wurde stärker, je trockener die Umweltbedingungen waren. Auch die Herkunft und genetische Ausstattung der untersuchten Pflanzen war entscheidend, da der Effekt zwischen den verschiedenen Populationen variierte. Auch wuchs die Korrelation zwischen der Regenmenge des Vorjahres und der Pflanzendichte. War die Pflanzendichte hoch, produzierten die Pflanzen im Schnitt weniger Samen, was das Forschungsteam als Reaktion auf die Konkurrenz deutet und somit ihre Theorie bestätigt.
Mehrere Strategien zum Überleben
Ganz anders hingegen das Ergebnis beim Gras Bromus fasciculatus: Die Keimung des Grases war unabhängig von der Herkunft und der Bewässerungsintensität der Eltern. Hier war vor allem das Samengewicht für den Keimerfolg ausschlaggebend.
Zusammengefasst bedeutet dies, dass bei Bromus fasciculatus im Gegensatz zu Biscutella didyma kein parentaler Umwelteffekt nachweisbar war. Die Beteiligten erklären sich dies damit, dass dieser einjährigen Pflanze andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um auf variable Umwelteinflüsse zu reagieren. Im Falle von Bromus fasciculatus kann die hohe Trockentoleranz der Grund für den fehlenden Effekt sein – es wird vermutet, dass dieser die Anlage einer größeren Samenbank unnötig macht.
Die Studie untermauert die Annahme, dass der parentale Umwelteffekt einer von mehreren möglichen Strategien ist, die Arten im Laufe der Evolution zum Überleben in extremen, variablen und damit unberechenbaren Umgebungen entwickelt haben. Der Effekt variiert auch innerhalb von Arten, was auf eine natürliche Selektion hinweisen kann. Es lässt sich also sagen, dass für einige Pflanzen der Effekt nützlich war, andere haben sich an ihre Situation auf andere Weise angepasst, z. B. durch neue Eigenschaften, die für ihre jeweilige Umgebung förderlich waren. Dies zeigt, dass unterschiedliche Wege zum Ziel führen können, die eigene Art zu sichern.
Quelle:
Lampei, C., Metz, J. und Tielbörger, K. (2017): Clinal population divergence in an adaptive parental environmental effect that adjusts seed banking. In: New Phytologist, (2. Februar 2017), doi: 10.1111/nph.14436.
Zum Weiterlesen:
- Anleitung zum Aufstehen - Schlüsselenzym zur Regulation der Samenruhe entdeckt
- Uralte Gerstensamen mit wertvollen Informationen entdeckt
- Systembiologische Samenforschung
Titelbild: Beim Brillenschötchen (Biscutella didyma) konnte ein Forschungsteam den parentalen Umwelteffekt nachweisen. (Bildquelle: © Christian Lampei)