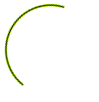Was Pflanzenforscher gegen Gifte im Essen tun können

Die Liste der Gifte in Nahrungs- und Futterpflanzen ist lang. (Quelle: © iStockphoto.com/pablo del rio sotelo)
Es vergeht kein Jahr ohne Lebensmittelskandal. Obwohl meist tierische Produkte betroffen sind, versuchen Pflanzenforscher, auch die Belastungen von ackerbaulicher Seite zu minimieren.
Nitrofen in Futtermitteln, Dioxin in Bio-Eiern, Nitrat im Salat, Pestizidcocktails auf Obst und Gemüse: Die Liste der Gifte, die Nahrungs- und Futterpflanzen in und an sich tragen, liest sich erschreckend und lässt sich fortsetzen. Schwermetalle, Mykotoxine – wie kommt es, dass all diese Stoffe immer wieder den Weg in die Nahrungskette finden?
Manche Stoffe sind unvermeidliche Begleiterscheinungen der heutigen Landwirtschaft. Nitratdünger und Pestizide machen die industrielle Landwirtschaft erst zu dem, was sie ist; so, wie eine ökologische Landwirtschaft frei von Mykotoxinen schwer vorzustellen ist. Die folgenden Abschnitte bieten einen Überblick, was sich hinter den Giftstoffen verbirgt, wie sie in die Pflanzen gelangen, und welche Ansätze die Forschung verfolgt, um diese Belastungen zu verringern.
Pestizide
Unter dem Begriff Pestizide versammeln sich alle Chemikalien, die Pflanzen vor Schädlingen schützen sollen: Herbizide gegen Unkräuter, Insektizide gegen Insekten, Fungizide gegen Pilzbefall und viele mehr. Im Pflanzenschutzgesetz und in der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung ist klar geregelt, welche Pflanzenschutzmittel in welcher Konzentration erlaubt sind. Meist sind die Grenzwerte so gewählt, dass diese Menge ein Leben lang regelmäßig ohne Risiko verzehrt werden könnte.

Ein Landwirt versprüht Pflanzenschutzmittel.
Bildquelle: © iStockphoto.com/Federico Rostagno
Kritiker beklagen, dass sich bei Tests immer wieder Produkte finden, auf denen sich zehn oder mehr verschiedene Pestizide gleichzeitig nachweisen lassen. Ob dieser „Cocktail“ von einzeln in der Menge unbedenklichen Bestandteilen auch in Kombination noch unbedenklich ist, dazu liegen praktisch keine wissenschaftlichen Daten vor. Zudem werden auch in Deutschland nicht oder nicht mehr zugelassene Pflanzenschutzmittel gelegentlich auf Obst und Gemüse gefunden.
So wurde das krebserregende und Erbgut verändernde Herbizid Nitrofen schon 1980 in Deutschland und 1988 EU-weit verboten. Dennoch sorgte es im Sommer 2002 für einen Skandal, weil Getreide, das an Hühner verfüttert wurde, damit kontaminiert war. Ursache war, dass das Getreide in einer Halle gelagert worden war, die früher Pestizide beherbergt hatte und seitdem nicht gründlich gereinigt worden war.
Zwar sind nicht alle Pestizide für Menschen gefährlich. Das Herbizid Glyphosat beispielsweise wirkt, indem es ein Enzym blockiert, das überhaupt nur in pflanzlichen Zellen existiert. Und oft gibt es alternative Möglichkeiten der biologischen Schädlingsbekämpfung, die sogar höhere Erträge erzielen, weil meist die Kulturpflanze selbst geringfügig unter Herbiziden leidet. Dennoch will die Pflanzenforschung einen Teil leisten, um hohe Erträge bei geringem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu ermöglichen.
Dazu gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Die erste besteht darin, die Pflanze selbst ihren Schutz produzieren zu lassen, wie im Fall der Bt-Technologie. Das Gift kann gezielt in den Pflanzenteilen exprimiert werden, von denen die Schädlinge sich ernähren. So gelangt viel weniger Insektizid aufs Feld, als wenn der Landwirt es mehrmals großflächig über alle Pflanzen ausbrächte.
Die zweite Möglichkeit besteht in natürlichen Resistenzen. Hat eine Pflanze selbst Abwehrmechanismen gegen Schädlinge, benötigt sie keine chemische Unterstützung durch den Landwirt. Oftmals finden sich im Genpool einer Art Resistenzen, die in Hochleistungssorten verloren gegangen sind. Forscher spüren diese Resistenzen in umfangreichen Analysen auf und übertragen die Resistenz per Züchtung oder Gentechnik in Hochleistungssorten.
Das Projekt GABI-PHENOME erforscht beispielsweise, wie Gerste und Pilze auf molekularer Ebene interagieren. Sie fanden eine Mutation eines Gersten-Gens, durch die Mehltau die Pflanzen nicht mehr befallen kann. Fungizide werden überflüssig.

Phänotypisierung von Gerste in den Umweltsimulationsanlagen des Helmholtz-Zentrums München.
Bildquelle: © Andreas Albert, München
Das Projekt GABI-FORTE untersucht ebenfalls einen natürlichen Mechanismus. Er könnte vor pilzlichen Wurzel- und Blattschädlingen schützen: Speziell bei Mais und Gerste besiedelt der Bodenpilz Piriformospora indica die Wurzeln, steigert die Resistenz gegen die genannten Schädlinge und verbessert zudem das Wachstum. Anhand der Modellpflanze Ackerschmalwand wollen die Forscher die beteiligten Gene und Mechanismen identifizieren.
Nitrat, Nitrit und Nitrosamine
Nicht für den Schutz der Pflanzen, sondern für ihre Versorgung mit Stickstoff setzen Landwirte Nitrate als Düngemittel ein. Durch die Magenflora und die Speicheldrüsen können im menschlichen Körper daraus giftiges Nitrit und krebserregende Nitrosamine gebildet werden.
Das Projekt GABI-NITROGEN verfolgt deshalb einen Ansatz, der teure und problematische Stickstoffdünger vermeidet: Mithilfe symbiotischer Bakterien in ihren Wurzelknöllchen können einige Pflanzen, vor allem Hülsenfrüchtler, den elementaren Stickstoff der Luft verwerten. Auch in einer Wildreisform fanden die Forscher ähnliche Fähigkeiten. Sie identifizierten die dafür relevanten Gen-Abschnitte, und hoffen nun, auch kommerziellen Reissorten diesen Weg der Stickstoffgewinnung eröffnen zu können.
Einen grundsätzlicheren Weg verfolgt das Projekt GABI-FUNCIN. Genomanalysen der Modellpflanze Ackerschmalwand sollen dabei helfen, die Stickstoffverwertung der Pflanzen zu verstehen. Mit diesem Wissen könnten die Forscher die Verwertung optimieren und so den Stickstoffbedarf verringern.
Mykotoxine im Biolandbau
So problematisch Düngemittel und Pestizide im Einzelfall sein können – auch ihre Abwesenheit kann zu Belastungen führen. Speziell der Verzicht auf Fungizide bei Getreide, wie er vor allem im Biolandbau üblich ist, bringt einen häufigeren Befall mit Schimmelpilzen mit sich. Die Erreger selbst sind für den Menschen unbedenklich. Sie sondern jedoch Giftstoffe ab, sogenannte Mykotoxine. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) schätzt, dass ein Viertel der Weltnahrungsproduktion Mykotoxine enthält. Je nach Art des Pilzes und des Gifts können die Substanzen krebserregend wirken, Nervensystem, Immunsystem, Organe, Erbgut oder Leibesfrucht schädigen.

Wird auf Fungizide beim Anbau verzichtet, so kann das böse enden.
Bildquelle: © iStockphoto.com/ Inga Nielsen
Eine Reihe von Maßnahmen kann Mykotoxinen im Getreide vorbeugen:
- nicht zu dichte, leicht abtrocknende Bestände
- kein Mais als Vorfrucht, da dessen Stroh nur langsam verrottet
- Boden wenden, um infiziertes Pflanzenmaterial von der Oberfläche zu entfernen
- Anbau wenig anfälliger Sorten
- zügige Trocknung des Ernteguts
- trockene Lagerung
- Entfernung der äußeren Kornschichten
Die Universität Hohenheim hat mit einem Projekt die „Grundlagen für die Züchtung auf verringerte Anfälligkeit gegen Mutterkorn bei Roggen und Triticale im Ökologischen Pflanzenbau“ gelegt. Dazu prüften die Forscher, welche Sorten unter den Bedingungen des ökologischen Landbaus besonders wenig anfällig sind und untersuchten eine Vielzahl seltenerer sowie kommerzieller Sorten auf Resistenzen. Das Ergebnis waren genotypische Informationen für die weitere Zucht.
In einem anderen Projekt entwickelten die Hohenheimer Forscher „Strategien zur Verbesserung der Qualität im Erntegut des Weizens durch Resistenz gegenüber Ährenfusariosen“. Dazu wurden mit Hilfe molekularer Marker quantitative trait loci (QTL) für eine entsprechende Pilzresistenz in zwei Winterweizen- und zwei Sommerweizenpopulationen identifiziert. QTL sind Bereiche des Erbguts, die für ein quantitatives phänotypisches Merkmal verantwortlich sind. Dieselben Resistenzquellen wurden phänotypisch im Rahmen einer rekurrenten Selektion eingesetzt, so dass ein experimenteller Vergleich von phänotypischer und Marker gestützter Selektion auf die Pilzresistenz möglich wurde. Die rekurrente Selektion ist eine zyklische Zuchtmethode mit dem Ziel, schrittweise die Frequenz günstiger Allele zu erhöhen, ohne Verlust der genetischen Variantenvielfalt.
Auch GABI-Forscher widmen sich dem Problem mit dem Projekt GABI-CEREHEALTH, indem sie auf genetischer Ebene nach Resistenzen und Resistenzmechanismen suchen.
Schwermetalle
Nicht mit den Pflanzen oder dem Ackerbau, sondern mit Böden und Altlasten hat die letzte Kategorie Giftstoffe zu tun, die über Pflanzen in die Nahrung gelangen können: Schwermetalle. Sie umfassen gut die Hälfte des Periodensystems, gelangen durch Bergbau, Hüttenindustrie und militärische Aktivitäten in die Umwelt. Zwar gibt es seit mehr als zehn Jahren Gesetze, die diesen Bodenbelastungen vorbeugen sollen, doch jahrzehntelang war dem nicht so.
Welche Elemente genau zu den Schwermetallen zählen, ist je nach Definition unterschiedlich. Einige sind als Spurenelemente für den Menschen wichtig – beispielsweise Chrom, Eisen, Kupfer und Mangan – doch die meisten sind giftig – wie Blei, Cadmium und Quecksilber.

Trotz vieler Verordnugen ist das giftige Schwermetall Cadmium oftmals in Böden nachweisbar.
Bildquelle: © iStockphoto.com/Andraž Cerar
Pflanzen nehmen die Schwermetalle aus dem Boden auf. Dabei unterscheiden Botaniker drei Typen: In Exkluderpflanzen ist der Schwermetallgehalt geringer als im Boden. Dazu zählen Gerste (-nkorn), Mais(-kolben) und Kartoffel(-knolle). Hafer(-stroh), Möhre(-nwurzel) und Kohl(-blätter) gelten als Indikatorpflanzen, weil sie Schwermetalle in einer Konzentration ansammeln, die der im Boden entspricht. Problematisch sind Akkumulatorpflanzen, genauer deren Blätter, weil sich in ihnen mehr Schwermetalle finden als im Boden. Betroffen sind beispielsweise Salat, Spinat und Sellerie(-knollen). Auch die Pflanze selbst wird durch Schwermetalle beeinträchtigt.
Offensichtliche Gegenmaßnahmen bestehen darin, Akkumulatorpflanzen nur auf leicht- oder unbelasteten Böden anzubauen, Flächen mit mittlerem Schwermetallgehalt nur für Industriepflanzen zu verwenden, und stark belastete Böden zu meiden.
Weil es schwierig ist, die Pflanzen daran zu hindern, Schwermetalle aus der Umwelt aufzunehmen, verfolgt die Forschung hier einen anderen Ansatz: Bestimmte Akkumulatorpflanzen, die bis zu ganz hohen Konzentrationen nicht durch Schwermetalle vergiftet werden, sollen belastete Böden sanieren, indem sie ihnen die Schwermetalle entziehen.
Dazu haben Forscher des Max-Planck-Instituts für molekulare Pflanzenphysiologie und des Leibniz-Instituts für Pflanzenbiochemie zwei Arten der Ackerschmalwand verglichen: Arabidopsis halleri, die große Mengen Schwermetalle akkumuliert, und die Modellpflanze Arabidopsis thaliana. Mithilfe gentechnischer Methoden gibt es inzwischen mehrere Pflanzen, die für die Sanierung schwermetallbelasteter Böden geeignet sind, unter anderem Pappeln gegen Cadmium und Kupfer sowie Indischer Senf gegen Selen. Das Thema hat so sehr an Bedeutung gewonnen, dass sich ihm ein eigenes Fachmagazin widmet, das Journal of Phytoremediation.
Kontrollen und Früherkennung mangelhaft
Um welche Art der Belastung es sich auch handelt: Dass Lebensmittelskandale die Verbraucher meist plötzlich und mit großer Wucht treffen, liegt mit an einer mangelhaften Früherkennung. Davon zeugen sowohl der belgische Dioxinskandal 1999 und der ukrainische 2010 als auch die BSE-Krise. Letztere hat noch ein weiteres Problem offenbart: die Risikokommunikation. Bis heute ist nicht sicher, ob BSE tatsächlich auf den Menschen übertragen werden und dort die Creutzfeld-Jacob-Krankheit (vCJD) auslösen kann. Möglich ist auch, dass die meisten Menschen eine natürliche Immunität besitzen. Dennoch löste BSE eine regelrechte Panik vor jeder Form von Rindfleisch aus.
Diese Beispiele zeigen aber auch, dass Lebensmittelskandale meist durch Vorsatz oder Schlampigkeit entstehen. Wenn Getreide in verseuchten Hallen gelagert wird, kann die Pflanzenforschung ebenso wenig vorbeugen wie gegen den verbotenen Einsatz des Antibiotikums Natamycin in Wein.
Trotz allen Fortschritts, den die Pflanzenforschung darin macht, schwer vermeidliche Nahrungsbelastungen zu minimieren, gilt deshalb: Ohne strikte Kontrollen und Systeme zur Früherkennung von Problemen in der Herstellungskette wird es auch weiterhin Lebensmittelskandale geben.