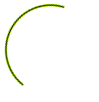Die Kunst der kollektiven Selbstorganisation
Sonnenblumen können sich optimal „absprechen“

Eine neigt sich nach rechts, eine nach links – so bekommt jede Pflanze genug Sonne! (Bildquelle: © pixabay; CC0)
Sonnenblumen können sich so miteinander organisieren, dass alle stets mit Blick zur Sonne stehen. Dieser für das Pflanzenreich ungewöhnliche Selbstorganisationsprozess kann sogar die Ölausbeute erhöhen.
Die einen Sonnenblumen neigen sich nach links, ihre Nachbarn nach rechts. So entsteht ein Zickzack-Muster, das nicht nur spannend aussieht, sondern auch das Interesse der Wissenschaft geweckt hat. Das Phänomen entdeckte man bei Feldversuchen: Bei Experimenten pflanzte ein Forschungsteam Sonnenblumen (Helianthus annuus) viel dichter als im kommerziellen Sonnenblumenanbau normalerweise üblich. Statt den fünf Pflanzen pro Quadratmeter wurde die Anzahl auf 10 bzw. 14 Einzelpflanzen pro m2 erhöht.
Das Kollektiv wird aktiv

So wohlgeordnet in Reih und Glied stehen Sonnenblumen nur im kommerziellen Anbau. In einem Experiment haben Forschende die Bestandesdichte von üblicherweise ca. fünf Pflanzen pro m2 auf 10 bzw. 14 Einzelpflanzen erhöht – mit überraschendem Ergebnis.
Bildquelle: © pixabay/ CC0
In den sehr dicht bewachsenen Versuchsfeldern begannen einige Pflanzen sich bereits in einer sehr frühen Wachstumsphase zufällig zu einer Seite zu neigen. Die Stielneigung dieser Sonnenblumenpflanzen verursachte bei den unmittelbaren Nachbarn ebenfalls eine Reaktion: Sie begann sich zu drehen - und zwar die die entgegengesetzte Richtung. So ging es weiter, bis sich alle zu einer Seite geneigt hatten. Diese Position behielten die Pflanzen dann auch im weiteren Wachstums- und Entwicklungsverlauf bei.
Kommunikatives sensorisches Netzwerk führt zur Selbstorganisation
Um diesen Mechanismus zu erklären, muss man zunächst darauf schauen, was die ersten Pflanzen dazu bewegte, die „Welle“ loszutreten. Pflanzen erkennen Signale aus ihrer Umgebung und senden zeitgleich ebenfalls Signale. Einige Sonnenblumen nahmen schon früh Schatten wahr, der durch den dichten Bewuchs zustande kam. Verantwortlich dafür sind Proteine, die Licht wahrnehmen – sogenannte Photorezeptoren, wie beispielsweise Phytochrome oder Cryptochrome.
Erhalten die Rezeptoren nicht genug Sonnenlicht, reagieren die Pflanzen auf diese Lichtsignale. Bei den Sonnenblumen im Experiment veränderte sich daraufhin der Winkel des Stielwachstums. Dadurch fiel auf ihre Nachbarn ebenfalls Schatten, der diese ebenfalls zwang aktiv zu werden. So „sprechen“ sich die Einzelpflanzen quasi ab, um individuell den optimalen Winkel des Stängels festzulegen.
Wie weitere Experimente zeigten, sind Phytochrome bei diesem Mechanismus entscheidend. Phytochrome messen das Verhältnis von hell- und dunkelrotem Licht und steuern dadurch Wachstums- und Entwicklungsschritte bei Pflanzen. Bei den Sonnenblumen konnte festgestellt werden, dass nur das Verhältnis der roten Lichtanteile einen Einfluss auf die Stielneigung hatte, nicht jedoch blaues Licht, welches von Cryptochromen detektiert wird.
Spontane Strukturbildung
Simulationen mithilfe zellulärer Automaten belegten, dass es sich bei der beobachteten Anordnung der Sonnenblumen im Feld tatsächlich um eine aufeinander aufbauende Selbstorganisation handelt. Das Forschungsteam konnte am Computer die Muster der Pflanzen modellieren und damit die strukturelle Ordnung vorhersagen, wie sie im Feld beobachtet wurde.

Ameisen sind ein Beispiel für soziale Insekten. Bei den Staaten bildenden Tierchen hat jedes einzelne eine definierte Funktion zu erfüllen. Ameisen kommunizieren untereinander, beispielsweise bei der Futtersuche. Dies geschieht in erster Linie über Duftstoffe.
Bildquelle: © pixabay/ CC0
Dass es in der Natur und bei Pflanzen zur spontanen Selbstorganisation kommt, ist nichts Neues. Das Phänomen ist sogar bereits bei Sonnenblumen bekannt. Denn die Kerne in ihren Blütenständen sind immer nach strengen mathematischen Prinzipien, der sogenannten Fibonacci-Folge angeordnet. In Pflanzenpopulationen wurde bisher jedoch nur ein primitiver Modus der Selbstorganisation beobachtet. Meistens geht es darum, die vorhandenen Ressourcen zu ergattern oder schlicht zu überleben.
Doch das hier beobachtete „Verhalten“ der Sonnenblumen, dass auf einem sensorischen Signal zwischen den Pflanzen beruht, gleicht eher der komplexen Kommunikation von Tieren. Beispielsweise sozialer Insekten, deren Interaktion vor allem auf chemischen Kommunikationsnetzwerken aufbaut.
Die verborgenen Talente haben Auswirkungen
Durch diese Selbstorganisation erhöhte sich in den dichten Beständen die Produktivität der Pflanzen. So wurden im Vergleich zur Kontrollgruppe 19 Prozent (bei 10 Pflanzen pro m2) bzw. 47 Prozent (bei 14 Pflanzen pro m2) mehr Öl gewonnen. In der Kontrollgruppe hatten die Forscher Pflanzen durch Drahtrahmen gezwungen, gerade nach oben zu wachsen. Die Pflanzen, die sich frei organisieren konnten, bildeten nicht nur mehr, sondern auch schwerere Kerne aus als die Kontrollpflanzen.
Das zeigt, dass das früh ausgebildete Neigungsmuster auch Auswirkungen auf die späteren Entwicklungsschritte und letztendlich die produzierte Biomasse hatte. Unter normalen Anbaubedingungen hat dieses Phänomen aber wohl keine Relevanz, weil die Bestandsdichten nicht so hoch sind. Aber trotzdem ein faszinierender Einblick in ungeahnte Fähigkeiten von Pflanzen, die eines Tages besser erforscht und vielleicht auch in die Sonnenblumenzüchtung Einzug finden werden.
Quelle:
López Pereira, M. et al. (2017): Light-mediated self-organization of sunflower stands increases oil yield in the field. In: PNAS, (10. Juli 2017), doi: 10.1073/pnas.1618990114.
Zum Weiterlesen:
- Immer der Sonne nach - Eine ausgeklügelte Taktik bewirkt die Ausrichtung junger Sonnenblumen
- Pflanzen im Dialog
- Steckbrief: Sonnenblume
- Mehr als nur schöne Blumen - Das Projekt SUNRISE treibt die Sonnenblumenzüchtung voran
- Die Ahnen der Sonnenblume sind Amerikaner
- Von der Esoterik zur Wissenschaft - Wahrnehmung und Austausch von Informationen bei Pflanzen
Titelbild: Eine neigt sich nach rechts, eine nach links – so bekommt jede Pflanze genug Sonne! (Bildquelle: © pixabay; CC0)