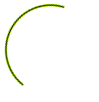Mais-Landrassen für neue Vielfalt
Das Projekt „MAZE“

Anbauversuch: Mais auf dem Feld. (Bildquelle: Tom Freudenberg / pict-images)
In Genbanken lagert ein großes Reservoir an genetischen Ressourcen – dazu gehören auch Landrassen, die sich in ihren Herkunftsregionen an ihre jeweilige Umwelt spezifisch angepasst haben. Auch für die Züchtung moderner Maissorten könnte dieser „genetische Schatz“ nützlich sein – Stichwort Klimawandel. Das Forschungsprojekt „MAZE“ zielt darauf ab, dieses Potenzial zu bergen.
Die genetische Vielfalt ist von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung unserer Kulturpflanzen – beispielsweise für ihre Anpassung an steigende Temperaturen oder Extremwettersituationen. Denn moderne Hochleistungssorten wurden gezielt auf wenige Eigenschaften wie hohe Erträge oder wichtige Krankheitsresistenzen „getrimmt“, Widerstandsfähigkeit gegenüber klimatischen Veränderungen, wie wir sie heute beobachten, standen dabei nicht im Vordergrund. Merkmale, die in alten Landrassen wahrscheinlich noch zu finden sind.

Klimatische Veränderungen, wie wir sie heute beobachten, standen bei der Züchtung von modernen Hochleistungssorten nicht im Vordergrund.
Bildquelle: Tom Freudenberg / pict-images
Zahlreiche dieser Pflanzen lagern in Genbanken rund um den Globus, sind aber bisher noch nicht ausreichend phänotypisch und genetisch charakterisiert. Ob sich hier genetische Schätze für die Züchtung von Mais (Zea mays L.) befinden, ist die zentrale Frage, der ein Konsortium im Forschungsprojekt „MAZE“ nachgeht.
Das Projekt MAZE wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Programm „Pflanzenzüchtungsforschung für die Bioökonomie“ gefördert. Die erste Projektphase lief von 2016 bis 2020. Danach schloss sich die zweite Projektphase an, die noch bis 2023 läuft.
Die Projektpartner und Ziele
Wissenschaftliche Partner:
- Technische Universität München - Pflanzenzüchtung: Prof. Dr. Chris-Carolin Schön (Projektkoordinatorin)
- Technische Universität München - Pflanzengenetik: Prof. Dr. Caroline Gutjahr
- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn: Prof. Dr. Frank Hochholdinger
- Julius-Maximilians-Universität Würzburg: Dr. Arthur Korte
- Helmholtz Zentrum München: Prof. Dr. Klaus F.X. Mayer
- Forschungszentrum Jülich: Dr. Kerstin Nagel
- Georg-August-Universität Göttingen: Prof. Dr. Henner Simianer
- Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf: Prof. Dr. Peter Westhoff
- Universität Hohenheim: Prof. Albrecht E. Melchinger (Phase I)
Industriepartner:
- KWS SAAT: Dr. Milena Ouzunova
- Computomics GmbH: Dr. Sebastian Schultheiss (ab Phase II)
„Das Projekt MAZE zielt darauf ab, genetische Ressourcen von Mais-Landrassen für die Maiszüchtung nutzbar zu machen“, sagt Projektkoordinatorin Prof. Chris-Carolin Schön von der TU München und ergänzt: „Dabei geht es uns konkret um quantitative Merkmale – also Merkmal, die von vielen Genen bestimmt werden – wie abiotische Stresstoleranz oder frühe Jugendentwicklung.“

Steckbrief: „MAZE“
- Versuchspflanze: Mais
- Förderprogramm: „Pflanzenzüchtungsforschung für die Bioökonomie“, BMBF
- Laufzeit: Phase 1: 2016 - 2020; Phase 2: 2020 - 2023
- Projektpartner: TUM, Uni Bonn, Uni Göttingen, JMU, Helmholtz Zentrum, FZJ, HHU, Uni Hohenheim (Phase I), KWS, Computomics (Phase II)
- Eintrag in unserer Projektdatenbank: MAZE I, MAZE II
Auf letzterer Eigenschaft liegt ein besonderer Fokus. Der Grund: Mais kann man in unseren Breiten erst relativ spät aussäen, denn der Samen benötigt für die Keimung eine Bodentemperatur von mindestens 8 Grad Celsius – Voraussetzungen, die meist erst ab Mitte April bis Mitte Mai vorherrschen. Doch das kann negative Folgen nach sich ziehen: Der Acker ist bis zum Bestandsschluss einem erhöhten Risiko für Bodenerosion durch Wind und Regen ausgesetzt. Auch Ertragsverluste drohen zunehmend aufgrund von Trockenheit und Hitze in der Zeit der Blütenentwicklung. Könnte man Mais früher aussäen, könnten diese Effekte abgemildert und die Vegetationszeit verlängert werden.
Das Vorgehen
Diversität innerhalb der Landrassen im Fokus
Das Konsortium hat sich zum Ziel gesetzt, die genetische Diversität innerhalb von Landrassen zu erforschen. Denn Landrassen sind im Vergleich zu modernen Hochleistungssorten genetisch nicht uniform. Drei vorselektierte Landrassen werden dazu unter die Lupe genommen. Bei den gewählten Landrassen handelt es sich um sogenannten Flint-Mais, einer Gruppe, die an die Anbaubedingungen in Europa schon angepasst ist. Sie unterscheiden sich von amerikanischen Maislinien, dem Dent-Mais. Moderne Hybridmaissorten sind Kreuzungen aus Flint- und Dent-Linien.
Die erste Schlüsselfrage, die im Projekt aufkam, war: Gibt es in den betrachteten Landrassen Allele bzw. Haplotypen, die im Elite-Zuchtmaterial fehlen? Und können so nützliche Eigenschaften aus den Landrassen für die Züchtung genutzt, aber gleichzeitig unliebsame Eigenschaften außen vor gelassen werden?
Um diese Fragen zu beantworten, wurden im ersten Schritt zunächst von den drei ausgewählten Landrassen vom Züchtungspartner KWS doppelhaploide, also vollständig reinerbige, Inzuchtlinien erzeugt. Ein recht aufwendiges Unterfangen, da die Landrassen sehr heterogen und zugleich züchterisch bisher unbearbeitet sind. Am Ende standen dem Forschungsteam von den Landrassen ungefähr 1.000 reinerbige Maislinien für die weiteren Untersuchungen zur Verfügung, die genotypisch und phänotypisch präzise charakterisiert wurden.
Anbauversuche unter verschiedenen Umweltbedingungen
Für die phänotypische Charakterisierung wurden die Maislinien in zweijährigen Feldversuche an elf verschiedenen Standorten in Europa angepflanzt – mit unterschiedlichen Böden und unter diversen Klimabedingungen. Auf diese Weise konnten die unterschiedlichen Umwelteffekte auf die Inzuchtlinien betrachtet werden. Insgesamt bis zu 50 ausgewählte Pflanzenmerkmale wie Pflanzenhöhe, Kälte- und Dürretoleranz, Photosyntheseeffizienz oder Anfälligkeit für Schadpilze standen dabei im Fokus. Die Vielfalt der Merkmalsausprägungen wurde im Projekt systematisch erfasst.

Für die phänotypische Charakterisierung wurden die Maislinien in zweijährigen Feldversuche an elf verschiedenen Standorten in Europa angepflanzt.
Bildquelle: Tom Freudenberg / pict-images
Genetische Analysen
Anschließend analysierten die Projektpartner das gesamte Genom der Pflanzen. Ziel: Identifizierung der merkmalsrelevanten Genomregionen und entsprechender Kandidatengene. Dabei interessiert das Konsortium vor allem die genetische Variation für die untersuchten Merkmale. Doch dafür mussten erst einige Grundlagen erarbeitet werden, da alle zu Projektbeginn verfügbaren Referenzsequenzen lediglich von amerikanischen Dent-Maislinien stammten. Daher wurden neue Referenzsequenzen von Flint-Linien sehr tief sequenziert und eingehend analysiert.
Um Kandidatengene zu identifizieren, wurden dann die Linien mit der besten und der schlechtesten Leistung unter Kühlebehandlung ausgewählt und deren Transkriptom analysiert. Unter anderem der Vergleich der Transkriptome führt auf die Spur von Genen, die für positive Merkmalsausprägungen verantwortlich sind. Identifizierte Kandidatengene werden kartiert und funktional weiter charakterisiert. Letztendlich bestätigt sich dann durch Anbauversuche mit Knock-out-Mutanten die entsprechende Gen-Funktion.
Langfristiges Ziel des Projektes ist es, über neuartige Kombinationen von diesen genetisch und funktionell charakterisierten Haplotypen Zugang zur vorhanden Biodiversität der Landrassen zu erhalten und sie praktisch zu nutzen. Denn sind die gefundenen Gene nachweislich für eine positive Eigenschaft verantwortlich, können sie am Ende von Züchtern über verschiedene Methoden wie markergestützte Selektion oder die Genschere CRISPR/Cas in Elitematerial genutzt werden.
Erkenntnisse sammeln und zugänglich machen
Die gewonnen genetischen und phänotypischen Informationen sammelt das Team in einem „Diversitätsatlas“. Ab der zweiten Phase wird dieser mit Daten zur Genexpression wie dem Transkriptom der einzelnen Linien erweitert. „Alle im Projekt gewonnenen Daten werden öffentlich zur Verfügung gestellt, sodass die Pflanzenforschung und die Züchtung von den neuen Erkenntnissen ebenfalls profitieren können“, betont Projektkoordinatorin Schön.
Gute Vorhersage für die Praxis
In der Pflanzenzüchtung ist neben der Charakterisierung einzelner Gene auch die genetische Vorhersage der phänotypischen Leistung in verschiedenen Umwelten von Interesse. Dafür hat das Konsortium statistische Vorhersagemodelle optimiert und dabei Daten aus den Feldversuchen einfließen lassen.

„Alle im Projekt gewonnenen Daten werden öffentlich zur Verfügung gestellt, sodass die Pflanzenforschung und die Züchtung von den neuen Erkenntnissen ebenfalls profitieren können“, betont Projektkoordinatorin Schön.
Bildquelle: Tom Freudenberg / pict-images
In der zweiten Projektphase startet dazu auch ein großes Selektionsexperiment mit einer der Landrassen. Dabei wird der Zuchtwert der Linien rein über die genomische Selektion aus den Erbanlagen mit statistischen Modellen abgeleitet. In mehreren Kreuzungszyklen werden die Linien in Bezug auf das Merkmal frühe Jugendentwicklung verbessert. Anschließend werden aus den Nachkommen doppelhaploide Linien erzeugt, die dann im Feld angebaut und erneut phänotypisch sowie genotypisch geprüft werden.
Weitere Forschungsaspekte
Neben den Flint-Landrassen untersucht das Projekt auch eine amerikanische Dent-Population. Ziel ist, nützliche Gene für die Züchtung von trockentoleranten Sorten zu finden. Auch der Blick unter die Erde, auf die Wurzeln und positive Synergien mit Mykorrhizapilzen, sind Gegenstand der Forschung. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass einige Maislinien von symbiotischen Pilzen deutlich profitieren.
Erste Ergebnisse sind vielversprechend
Das Konsortium konnte bereits in der ersten Projektphase den Beweis erbringen, dass genetisches Material von Landrassen für die Verbesserung von Merkmalen in modernen Maissorten gewinnbringend eingesetzt werden kann: Einige der Landrassen wiesen interessante Haplotypen für das Merkmal Kältetoleranz auf und waren den Elitelinien in diesem Merkmal überlegen (siehe: Mayer et al., 2020). Ein großer Schritt auf dem Weg zu Maissorten, die früher zur Aussaat kommen können.
Es wurden auch bedeutende genetische Grundlagen geschaffen: Das Team lieferte zum Beispiel Referenzsequenzen von vier verschiedenen europäischen Maislinien (Haberer et al., 2020). Damit konnte nicht nur die eigene genetische Arbeit an den ausgewählten Flint-Mais-Landrassen vorangetrieben werden. Die Projektpartner zeigten in der Publikation auch relevante Unterschiede zu nordamerikanischen Linien auf. Diese Daten können Forschende weltweit nutzen, um den züchterischen Fortschritt bei Mais zu beschleunigen.
Weiterführende Informationen:
- Projektwebseite: www.europeanmaize.net
Ausgewählte Publikationen aus dem Projekt:
- Hölker, A.C. et al. (2022): Theoretical and experimental assessment of genome-based prediction in landraces of allogamous crops. In: PNAS, (29. April 2022), doi: 10.1073/pnas.2121797119.
- Mayer, M. et al. (2022): Genetic diversity of European maize landraces: Dataset on the molecular and phenotypic variation of derived doubled-haploid populations. In: Data in Brief, (Juni 2022), doi: 10.1016/j.dib.2022.108164.
- Mayer, M. et al. (2020): Discovery of beneficial haplotypes for complex traits in maize landraces. In: Nature Communications, (2. Oktober 2020), doi: 10.1038/s41467-020-18683-3.
- Haberer, G. et al. (2020): European maize genomes highlight intraspecies variation in repeat and gene content. In: Nature Genetics, (27. Juli 2020), doi: 10.1038/s41588-020-0671-9.
- Eine Liste der Publikationen finden Sie auf der Projektwebseite unter: Publications
Zum Weiterlesen auf Pflanzenforschung.de:
- Alles Mais, oder? - Das Genom europäischer Maislinien unterscheidet sich deutlich vom nordamerikanischen Mais
- Landrassen in Gefahr? - Genbanken als Tresore der pflanzlichen Vielfalt
- Maisstroh als Rohstoff nutzen - Das Projekt „CornWall“
- Jäger des noch nicht verlorenen Schatzes - Wo gibt es noch die wilden Verwandten unserer Nutzpflanzen?
Titelbild: Anbauversuch: Mais auf dem Feld. (Bildquelle: Tom Freudenberg / pict-images)
PLANT 2030 vereint die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsaktivitäten im Bereich der angewandten Pflanzenforschung. Derzeit umfasst dies die nationalen Förderinitiativen: „Pflanzenzüchtungsforschung für die Bioökonomie“ und „Bioökonomie International“. Weitere Informationen finden Sie unter: PLANT 2030